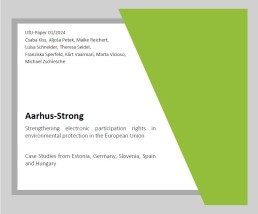UfU-Projekte in Kasachstan widmen sich den Umweltproblemen in der Landwirtschaft
UfU-Projekte in Kasachstan widmen sich den Umweltproblemen in der Landwirtschaft
Am 17. Juli 2024 hatte das Unabhängige Institut für Umweltfragen (UfU) in Berlin die Ehre, eine Delegation aus Kasachstan zu empfangen, darunter Herrn Aslan Abdraimov, den stellvertretenden Minister für Wasserressourcen und Bewässerung, und Frau Aziza Dyussenova, die Erste Sekretärin der Botschaft von Kasachstan in Deutschland. Dieser Besuch war ein wichtiger Schritt in der Zusammenarbeit bei der Bewältigung kritischer Umweltprobleme in Kasachstan.
Während des Treffens gaben UfU-Vertreter, darunter Dr. Michael Zschiesche, Sami Çeltikoğlu und Dr. Arne Reck, einen umfassenden Überblick über laufende und geplante Projekte in Kasachstan und erörterten umweltpolitische Herausforderungen, denen sich Kasachstan heute und in Zukunft stellen muss. Im Mittelpunkt der Diskussionen standen die UfU-Projekte ZIVIKLI, Projekt4646 und CarbonIQ und deren wissenschaftliche Erkenntnisse. Diese Projekte leisten einen einzigartigen Beitrag zu nachhaltigen landwirtschaftlichen Praktiken und zur Anpassung an den Klimawandel in Kasachstan.
Warum arbeitet das UfU in Kasachstan?
Kasachstan spielt eine wichtige Rolle in der globalen Lebensmittelversorgungskette. Die Landwirtschaft ist ein entscheidendes Element für die wirtschaftliche, soziale und ökologische Entwicklung Kasachstans. Mehr als 79,3 % der Landesfläche sind der landwirtschaftlichen Produktion gewidmet – etwa 29.669.700 Hektar Ackerland (Weltbank, 2021; Macrotrends, 2020). Die Landwirtschaft Kasachstans bringt gigantische Exporte von Weizen und Mehl hervor. Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) prognostiziert, dass bis 2030 die Weizenproduktion Kasachstans, der Ukraine und Russlands zusammengenommen 25-30 % der weltweiten Weizenexporte ausmachen wird, während es heute bereits 21 % sind. Die Rolle Kasachstans als Nahrungsmittellieferant ist besonders wichtig für den Nahen Osten und Nordafrika und damit auch für deren Nahrungsmittelsicherheit.
Aufgrund des Klimawandels steht die kasachische Landwirtschaft vor Herausforderungen wie Dürren oder Überschwemmungen und einer Veränderung der jährlichen Durchschnittstemperatur, welche die Nahrungsmittelproduktion in Zukunft gefährden könnten, wenn Kasachstan nicht in der Lage ist, seine Landwirtschaft an die sich verändernden Umweltbedingungen anzupassen. Gleichzeitig suchen die kasachischen Landwirte nach alternativen Möglichkeiten, ihre Produkte umweltfreundlich und mit geringeren Auswirkungen auf Boden und Natur zu produzieren, da sich Kasachstan wie andere Länder das Ziel gesetzt hat, seine Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen bis 2050 von über 80 % auf etwa 50 % zu reduzieren (Karatayev et al. 2022). Das Land will außerdem bis 2060 kohlenstoffneutral werden (Weltbank, 2023). Da das UfU über umfangreiche Erfahrungen im Bereich der Bodenrenaturierung und des Bodenschutzes verfügt, ist es unser Ziel, die Landwirte in Kasachstan bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen und einen Beitrag zur Sicherung der Welternährung bei gleichzeitiger Gewährleistung einer umweltfreundlichen Landwirtschaft zu leisten.
Das Ministerium für Wasserressourcen und Bewässerung von Kasachstan
Die Bereitstellung von Wasser für die Landwirtschaft ist einer der kritischsten Punkte, wenn es darum geht, die Nahrungsmittelproduktion zu sichern. Kasachstan steht vor großen Herausforderungen wie Wasserknappheit für die Landwirtschaft, häufige Dürren und gelegentliche schwere Überschwemmungen aufgrund der sich ändernden klimatischen Bedingungen. Deshalb hat Kasachstan vor einem Jahr ein neues Ministerium gegründet, das Ministerium für Wasserressourcen und Bewässerung. Anders als in Deutschland, wo es kein eigenes Ministerium für diese Thematik gibt, spielt das Ministerium eine entscheidende Rolle bei der Verwaltung der im Land verfügbaren Wasserquellen und bei der Bewältigung von Klimaextremen. Um dies zu unterstützen, liefert das UfU strategische Erkenntnisse aus seinen Projekten für einen robusten Rahmen zur Umsetzung nachhaltiger landwirtschaftlicher Praktiken. Das Ministerium ist bestrebt, die im Rahmen dieser Projekte entwickelten Daten und Strategien zu nutzen, um die nationale Politik zu informieren und praktische Lösungen vor Ort umzusetzen.
Besuch von kasachischen Studenten
Am 18. Juli 2024 empfing das UfU im Rahmen des „Landwirtschaftlichen Praktikumsprogramms in Brandenburg“ von Apollo e.V. auch Studierende mit landwirtschaftlichem Hintergrund von verschiedenen kasachischen Universitäten. Die Studierenden wurden über die Auswirkungen des Klimawandels auf die Landwirtschaft und die innovativen Lösungen, die in den Projekten des UfU umgesetzt werden, informiert. Die von Sami Çeltikoğlu und Dr. Arne Reck geleitete Veranstaltung weckte großes Interesse am CarbonIQ-Projekt, insbesondere an dessen Potenzial, landwirtschaftliche Praktiken in Kasachstan zu verändern.
Der Besuch der kasachischen Delegation an der UfU war ein wichtiger Schritt zur Stärkung der Umweltkooperation zwischen Kasachstan und Deutschland. Die ausführlichen Gespräche und Projekteinblicke bildeten eine solide Grundlage für die künftige Zusammenarbeit mit dem Ziel, nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken und die Klimaresilienz in Kasachstan zu verbessern. Das UfU ist weiterhin entschlossen, Kasachstan auf seinem Weg zu ökologischer Nachhaltigkeit und Klimaanpassung zu unterstützen.
UfU Projekte in Kasachstan
Projekt 4646
Ziel des Projektes „Projekt4646“ ist eine Machtbarkeitsstudie zu den Themen „Klimawandel in der Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Know-how-Transfer zwischen Deutschland und der Republik Kasachstan“ und umfasst zwei Studienphasen. Im ersten Schritt erfolgt eine Vorstudie über die Wahrnehmung des Klimawandels durch Landwirt*innen, politische Entscheidungsträger*innen und landwirtschaftliche Akteur*innen anhand von Befragungen im Fokusgruppenformat. Im zweiten Schritt erfolgt eine direkte Befragung von Landwirt*innen bezüglich der Wahrnehmung der Klimakrise mittels einer Umfrage.
Projekt CarbonIQ
Mit der Pilotstudie „CarbonIQ“ soll eine Entscheidungsgrundlage für die Durchführbarkeit von „Carbon Farming“ in Kasachstan als wichtige Umwelt- und Klimaschutztechnologie geschaffen werden. Konkret zielt das Projekt „CarbonIQ“ darauf ab, das Potenzial der Kohlenstoffspeicherung in den Böden Kasachstans zu bewerten, die Kapazität für „Carbon Farming“ abzuschätzen und wichtige Effekte wie die Förderung der Biodiversität zu untersuchen. „CarbonIQ“ unterstützt auch die wirtschaftliche Nachhaltigkeit, indem das Potenzial der Kohlenstoffspeicherung im Boden für die Landwirt*innen nutzbar gemacht wird. Auf diese Weise können Landwirt*innen konkret sehen, wie sie durch nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken sowohl einen Beitrag für die Natur als auch für ihr eigenes Einkommen leisten können.
Erfolgreiche Abschlussveranstaltung in Birkenwerder mit beeindruckenden Ergebnissen!

18. Juli 2024
Erfolgreiche Abschlussveranstaltung in Birkenwerder mit beeindruckenden Ergebnissen!
Am vergangenen Freitag fand die Abschlussveranstaltung des Energiesparprojektes in Birkenwerder statt. Bürgermeister Stephan Zimniok zeichnete die Teilnehmer aus der Grundschule Pestalozzi, den Kitas Birkenpilz, Festung Krümelstein und Rumpelstilzchen sowie dem Rathaus Birkenwerder für ihr Engagement aus.
Diese Erziehungs- und Bildungseinrichtungen haben mit dem UfU in den letzten vier Jahren jeweils Energiesparprojekte durchgeführt. Diese Energiesparprojekte, welche das UfU seit mehr als 25 Jahren an Schulen und Kitas in Deutschland durchführt, haben mehrere Ziele: Zum einen soll durch Änderung des Nutzerverhaltens der Ressourcenverbrauch gesenkt werden. Zum anderen sollen vor allem die Kinder und Schüler*innen durch eben diese Änderung des Nutzerverhaltens Selbstwirksamkeit erfahren und anhand des Verbrauchs der eigenen Schule/Kita lernen, dass sie etwas bewegen können.
Dazu veranstaltet das UfU zahlreiche Projekttage zu Energie, Klimaschutz, Heizen, Ressourcenverbrauch und anderen Themen und schließt dabei auch das Lehrpersonal und Erzieher*innen mit ein.
Im Rahmen des Energiesparprojektes Birkenwerder wurden unter anderem umfassende Schulungen für die Mitarbeiter*innen des Rathauses sowie Erzieher*innen-Schulungen für die Kitas durchgeführt. So können die Lehrende ihr Wissen direkt an die Kinder weitergeben.
Trotz der Herausforderungen durch die Corona-Pandemie konnten bedeutende Einsparungen erreicht werden: Insgesamt wurden Einsparungen von fast 14.000€ erreicht. Betrachtet man nur die beiden vergangen Jahre sind Einsparungen von 48.500€ erzielt worden. Insbesondere für Kommunen mit mehreren Schulen, sind die Energiesparprojekte besonders interessant, dass sie die oft klammen Kassen etwas entlasten, eine sinnvolle Bildungsmaßnahme sind und gleichzeitig auch etwas für den Klimaschutz tun. Die Umsetzung dieser führte zu insgesamt 22,24 Tonnen weniger CO2-Emissionen beim benötigten Strom und 89,83 Tonnen weniger CO2-Emissionen durch Einsparungen bei der Wärme.
Besonders bemerkenswert ist, dass der Erfolg des Projekts ausschließlich durch Veränderungen im Nutzerverhalten erzielt wurde und nicht etwa durch neue technische Ausstattung oder Sanierung. Abschließend rief Bürgermeister Zimniok dazu auf, den eingeschlagenen Weg weiter zu verfolgen und das Engagement für eine nachhaltige Entwicklung fortzusetzen.
Wer mehr über unsere Energiesparprojekte wissen möchte findet hier Informationen: https://www.ufu.de/energiesparen-an-schulen/
Eure Schule oder Kita soll auch mitmachen? Schreibt eine E-Mail an oliver.ritter@ufu.de
Bessere Beteiligungsportale für Europa – Leitfaden mit Good-Practice Beispielen ist online!
17. Juli 2024
Der Leitfaden Aarhus Digital mit internationalen Good-Practice Beispielen für Beteiligungsportale in Umweltfragen ist online. Er bietet eine Übersicht über Good-Practices für die Gestaltung von digitalen Beteiligungsportalen in 11 Ländern, mit einem Fokus auf Beteiligung bei Umweltverträglichkeitsprüfungen. Online-Beteiligungsportale für die Zivilgesellschaft gibt es sowohl auf nationaler als auch auf regionaler Ebene. Ihr Ziel ist es, alle Informationen zu bestimmten Beteiligungsverfahren zu bündeln.
Der Leitfaden richtet sich insbesondere an die Umweltbehörden der EU-Mitgliedstaaten, die Beteiligungsportale umsetzen und betreiben. Behörden können sich mit Hilfe des Leitfadens gezielt über die Empfehlungen zur digitalen Öffentlichkeitsbeteiligung nach der Aarhus-Konvention informieren und sich von den Good-Practice-Beispielen aus verschiedenen, auch außereuropäischen Ländern inspirieren lassen. Darüber hinaus dient er auch der Zivilgesellschaft als Überblick über die unterschiedlichen digitalen Möglichkeiten zur effektiven Beteiligung.
Eine länderübergreifende Studie des UfU hat gezeigt, dass die Ausgestaltung von Umweltverträglichkeitsprüfungsportalen (UVP-Portalen) in fast allen europäischen Ländern mangelhaft ist und damit die Aarhus-Konvention nicht vollständig umgesetzt wird. Dabei ist effektive Öffentlichkeitsbeteiligung in Umweltfragen ein zentraler Bestandteil für solide Planungs- und Genehmigungsentscheidungen und stärkt die demokratische Teilhabe. Digitale Beteiligungsportale können entscheidend dazu beitragen, formelle Beteiligungsverfahren zu vereinfachen und zugänglicher zu machen.
Der Leitfaden gibt einen Überblick über die wichtigsten Funktionen und Anforderungen an gute Beteiligungsportale und wird durch Good-Practice-Beispiele aus 11 Ländern veranschaulicht. Folgende Länder wurde von uns untersucht: Deutschland, Estland, Frankreich, Irland, Kanada, Kasachstan, Österreich, Slowenien, Spanien, Ukraine und die USA.
Die Good-Practices haben wir in folgenden Kategorien gesammelt:
- Ein zentrales Portal: Um Bürger*innen erfolgreich zu beteiligen ist es notwendig, dass es ein zentrales Beteiligungsportal gibt, welches alle Umweltverträglichkeitsprüfungen unabhängig von der Zuständigkeit der Behörde innerhalb eines Landes auflistet.
- Kartenfunktion: Mit einer graphischen Übersicht über die aktuell laufenden UVP-Verfahren können sich Bürger*innen auf einfachem Wege informieren, ob es Verfahren in der Heimatregion oder einen bestimmten Ort von Interesse gibt.
- Dokumentenmanagement: Eine übersichtliche Bereitstellung der Dokumente, leicht verständliche Ablagesysteme und nicht-technischen Zusammenfassungen sind für eine erfolgreiche Beteiligung notwendig.
- Kommentarfunktion: Mithilfe einer Kommentarfunktion können Stellungnahmen schnell und einfach abgegeben und leichter von den Behörden ausgewertet werden.
- Archivfunktion: Die Archivfunktion ermöglicht den Nutzer*innen das Suchen und Einsehen von bereits abgeschlossenen Verfahren.
- Apps und Chatbots: Apps und Chatbots könne eine besonders nutzungsfreundliche und effektive Öffentlichkeitsbeteiligung gewährleisten und mit bestehenden UVP-Portalen verknüpft werden.
- Darüber hinaus sollten die Behörden mehr über Social Media auf Beteiligungsportale und digitale Verfahren aufmerksam machen.
Der Leitfaden bietet außerdem Hintergrundinformationen zur Aarhus-Konvention, eine Toolbox für digitale Öffentlichkeitsbeteiligung und weiterführende Informationen zu digitalen Erörterungsterminen.
Broschüre zur Integration von BNE und politischer Bildung in der beruflichen Bildung
10. Juni 2024

UfU veröffentlicht Broschüre zur erfolgreichen Integration von BNE und politischer Bildung in der beruflichen Bildung
Eine politische Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) kann systemisches Denken als Schlüsselqualifikation zum Lösen komplexer Probleme fördern
Mit der Förderung von Kritik- und Reflexionsfähigkeit befähigt eine Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) Lernende zu zukunftsfähigem Denken und Handeln, unter Berücksichtigung planetarer Grenzen. Dieses Wissen soll helfen, die Auswirkungen des eigenen Handelns auf die Welt zu verstehen und verantwortungsvolle, nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Häufig wird bisher leider vor allem auf individuelles Handeln und Konsumentscheidungen fokussiert. Das Verständnis von kollektiven Handlungsprozessen sowie bestehenden Macht- und Herrschaftsverhältnissen, die wichtige Entscheidungen für eine gute Zukunft für alle Menschen maßgeblich prägen, werden häufig vernachlässigt.
Um die multiplen gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit erfolgreich anzugehen, sind politische, wirtschaftliche, soziale und ökologische Veränderungen auf globaler Ebene nötig. Die didaktischen Kenntnisse aus der politischen Bildung, in denen Menschen zum Hinterfragen, Widersprechen, Andersdenken und Ausprobieren ermutigt werden (Eicker & Holfelder, 2020), könnten die Konzepte der BNE bereichern und politisches Handeln fördern ohne zu indoktrinieren.
Gerade der Bereich berufliche Bildung, zu dem sowohl die Berufsschulen als öffentliche Bildungseinrichtungen, als auch wirtschaftliche Betriebe gehören, sollte zunehmend als Erfahrungs- und Gestaltungsraum gesellschaftlicher Transformation verstanden werden. 1,22 Millionen Menschen in Deutschland, die sich zurzeit in der beruflichen Ausbildung befinden (Statista, 2024) dürfen nicht nur berufsspezifische Lerninhalte vermittelt bekommen, sondern müssen unbedingt zu kritischem und systemischem Denken angeregt werden, um die Zusammenhänge komplexer globaler Zustände verstehen, reflektieren und hinterfragen zu können. Die dadurch erworbenen Handlungs- und Gestaltungskompetenzen befähigen Lernende, Prozesse im Sinne der sozial ökologischen Transformation an ihren Berufsschulen, Betrieben und künftig in der Gesellschaft aktiv mitzugestalten.
Ansätze, wie das gelingen kann, finden sich an der Schnittstelle zwischen beruflicher Bildung für nachhaltige Entwicklung und politischer Bildung. Dazu beschäftigten wir uns zwischen Juli 2023 und Mai 2024 explorativ im Projekt „KlimaKompetenzen in der beruflichen Bildung stärken: Berufsbilder mit politischer Bildung und BNE zukunftsfähig machen“ mit über 100 Akteur*innen und Expert*innen in 3 Veranstaltungen. Die gewonnenen Erkenntnisse haben wir in einer Broschüre gebündelt.
Berufsschulleitungen, -lehrer*innen, -schüler*innen, Ausbildungsbetriebe, Multiplikator*innen, Bildungsträger sowie Vertreter*innen von strukturell relevanten Bereichen (z.B. Kultusministerkonferenz (KMK), Berufsschulverbände, Gewerkschaften) und weitere interessierte Leser*innen finden in dieser Broschüre Anregungen und praktische Handlungsempfehlungen zu folgenden Fragestellungen:
- Wie kann (B)BNE als politischer Lernprozess gestaltet werden?
- Wie kann (politische) BNE stärker im berufsspezifischen Kontext verankert werden?
- Wie kann mehr nachhaltige und politische Praxis in der Berufsbildung gelebt werden?
Wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen Teilnehmenden unserer Veranstaltungen im Rahmen dieses Projekts, die mit ihrem Wissen und ihren praktischen Erfahrungen maßgeblich an der Entstehung dieser Handreichung mitgewirkt haben!
Umwelt braucht aktive Demokratie – UfU ruft zur Wahl am 09. Juni auf!

06. Juni 2024
Umwelt braucht aktive Demokratie – UfU ruft zur Wahl am 09. Juni auf!
Am kommenden Sonntag wird überall in Deutschland das Europäische Parlament gewählt, zudem finden in zahlreichen Bundesländern – so in Baden-Württemberg, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen und Sachsen-Anhalt – Kommunalwahlen statt. Das UfU ruft dazu auf, die Wahlchance wahrzunehmen und die Demokratie zu stärken. In Zeiten wachsender rechtspopulistischer und rechtsextremer Positionen ist es besonders wichtig, nicht „wahlmüde“ zu werden und demokratischen Parteien, welche sich für eine Nachhaltige Entwicklung einsetzen, den Rücken zu stärken.
Denn eine gute Zukunft für alle kann nur gelingen, wenn Umweltschutz ernst genommen und der menschengemachte Klimawandel anerkannt wird sowie notwendige und ambitionierte Maßnahmen umgesetzt werden. Rückhalt und die konkreten Realisierungen finden dabei auf vielen gesellschaftlichen Ebenen statt: sowohl lokal vor Ort, beispielsweise durch Maßnahmen in den Bereichen Stadtgrün und nachhaltige Mobilität, sowie bis hin zur europäischen Ebene und darüber hinaus, beispielsweise durch die Gestaltung von weitsichtiger wie solidarischer Klimapolitik. Deshalb spielen die Wahlen auf allen Ebenen eine Rolle.
Die Rahmenbedingungen, in denen wir uns als Umweltorganisation tagtäglich bewegen, sind maßgeblich von der Politik mitgestaltet. Diese haben erheblichen Einfluss darauf, welchen impact unsere Arbeit haben kann. Die Herausforderungen, vor denen wir stehen – von der Klimakrise über den Schutz der Biodiversität bis hin zur Sicherung einer nachhaltigen Lebensweise – erfordern mutige und entschlossene Entscheidungen. Diese benötigen Druck und Mandate aus der Zivilgesellschaft. Deshalb zählt am Sonntag jede Stimme. Das UfU ermutigt daher nachdrücklich zur Stimmabgabe!
Autorin: Alina Beigang, UfU.
Ausgezeichnetes UfU-Projekt: kliQ 2.0 ist KlimaSchutzPartner des Jahres 2024

16. Mai 2024
Ausgezeichnetes UfU-Projekt: kliQ 2.0 ist KlimaSchutzPartner des Jahres 2024
Eigene kreative Ideen der Schülerinnen und Schüler zum Energiesparen und Klimaschutz umsetzen. Das ist die Grundidee des Projekts kliQ 2.0. Im laufenden Schuljahr 2023/24 machen zehn Schulen aus dem Bezirk Steglitz-Zehlendorf mit und können bereits beachtliche Erfolge vorweisen. Das Projekt wurde gerade bei den Berliner Energietagen mit dem Publikumspreis als „KlimaSchutzPartner des Jahres 2024“ ausgezeichnet.
Das Fachpublikum der Berliner Energietage hatte die Wahl zwischen 18 eingereichten Projekten, kliQ 2.0 erhielt mit Abstand die meisten Stimmen. Der Preis wurde in der Berliner IHK durch Britta Behrendt, Staatssekretärin für Klimaschutz und Umwelt, überreicht und ist mit 1.000 Euro dotiert. Anstatt nur theoretisches Wissen über den Klimawandel zu vermitteln, steht bei kliQ 2.0 das praktische Lernen und Umsetzen im Fokus. Junge Menschen können so direkt zum Energiesparen und Klimaschutz beitragen.
Klassenräume werden z.B. mit Nebelmaschinen eingenebelt, um energiesparendes und gleichzeitig pandemietaugliches Lüftungsverhalten zu verstehen. Lufttemperaturen werden gemessen, um keinen Kubikmeter Erdgas zu verschwenden. Mit Wärmebild-Kameras werden die Schwachstellen der Gebäudehüllen herausgefunden. An der Wilma-Rudolph-Schule wurde eine Challenge gestartet, welche Gruppe die effektivste Wärmedämmung um einen Schuhkarton baut. Zum Verständnis von Stromverbrauch wurde die Leistungsaufnahme von Elektrogeräten gemessen und die ermittelte Leistung als mechanische Leistung mit einem Fahrrad erbracht. Lichtschalter wurden markiert, um die Fensterreihe der Lampen frühzeitig ausschalten zu können.
Zur Anerkennung des Engagements werden die aktivsten Gruppen zu Fahrradkino-Events eingeladen. Lustige oder spannende Kurzfilme werden in ihrer Sporthalle oder Aula gezeigt. Der Strom dafür wird von jeweils 10 Schüler*innen auf Fahrrädern mit Generatoren selbst erzeugt bzw. „erstrampelt“. Ein oftmals mitreißendes Event für die gesamte Schulgemeinschaft.
Klimaschutz und Energiesparen an Schulen lohnen sich, auch finanziell. Zum einen sind Schulen mit den dazugehörigen Sportanlagen die größten Energieverbraucher unter den öffentlichen Gebäuden. Für eine mittelgroße Schule fallen rund 150.000 Euro an Energiekosten pro Jahr an. Zum anderen ist es wichtig, Schülerinnen und Schüler für das Thema Klimaschutz zu begeistern. Durch konkrete Energiesparprojekte tragen Schüler*innen das Gelernte aus der Schule nach Hause und die Projekte entfalten Breitenwirkung.
Im Rahmen des Projekts erhalten die interessierten Schulen bei ihren Aktivitäten zur Senkung des Energieverbrauchs und Maßnahmen zum Schutz des Klimas professionelle Unterstützung. Die Expert*innen des Unabhängigen Instituts für Umweltfragen UfU e.V. helfen, die kreativen Ideen auch praktisch umzusetzen.
Ziel des im laufenden Schuljahr deutlich erweiterten Projekts „klimafreundliches Quartier kliQ 2.0“ ist es, reale Einsparungen in den Schulen zu erzielen und zu dokumentieren. Das Projekt wird von der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt mit Mitteln des Berliner Energie-und Klimaschutzprogramms (BEK) sowie durch den Bezirk Steglitz-Zehlendorf gefördert. Durch die Kombination der Fördermittel des BEK und des Bezirks konnte das Projekt im Schuljahr 2023/24 deutlich ausgeweitet werden.
Die Erfolge des Projekts zeigen sich auch in der Praxis. So konnte beispielsweise der Heizenergieverbrauch an der Wilma-Rudolph-Schule 2023 gegenüber dem Jahr 2022 witterungsbereinigt um 7% reduziert werden. Das bringt nicht nur finanzielle Einsparungen von über 10.000 Euro allein an dieser Schule, sondern bedeutet auch verringerte CO2-Emissionen und einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz. Besondere Erfolge gab es in einzelnen Gebäuden der Mühlenau-Grundschule. Im Hauptgebäude konnte 35% der Heizenergie eingespart werden, in der Sporthalle ca. 37% beim Stromverbrauch.
2024 hat das Projekt zusätzlichen Schub durch das Frei Day-Programm erhalten: Schüler*innen bearbeiten an einem Tag pro Woche selbst gewählte Aktionen zum Thema Nachhaltigkeit. Eine der Frei Day-Schulen ist die Anna-Essinger-Grundschule in Zehlendorf. Pionier ist die Schweizerhof Grundschule, die bereits seit 3 Jahren mit Begeisterung beim Frei Day dabei ist. Unlängst bekam die Schule Besuch aus Bulgarien. Die Delegation von dort ließ sich Vorgehensweise und Erfolge live vorführen.
Ursprung des Projekts kliQ 2.0 ist u.a. die Initiative engagierter Bürger*innen, die ihren Kiez zwischen Krumme Lanke, Onkel Toms Hütte und Oskar-Helene-Heim immer stärker zu einem klimafreundlichen Quartier („kliQ“) entwickeln wollen. Dazu kamen das BNE-Zentrum und engagierte Lehrkräfte, die für die Bildung ihrer Schützlinge in Sachen Klimaschutz brennen.
Weitere Infos zum Projekt gibt es hier:
https://www.klimaschutzpartner-berlin.de/projekt/kliq-20-klimaschutzprojekte-an-schulen-in-steglitz-zehlendorf-628
Aktive Klima-Schulen der Stadt Oranienburg auch 2024 ausgezeichnet
25. April 2024
Was können wir an unserer Schule tun, um schnellstmöglich klimaneutral zu werden? Mit viel Engagement und kreativen Ideen sind Schülerinnen und Schüler von sechs städtischen Schulen in Oranienburg aktiv geworden. Sie wurden am 25. April 2024 bei einer Festveranstaltung in der Orangerie des Schlossparks Oranienburg durch Bürgermeister Alexander Laesicke geehrt.
Schulen gehören zu den höchsten Energieverbrauchern unter den öffentlichen Gebäuden. Klimaschutz und Energiesparen in Bildungseinrichtungen bringen damit einen dreifachen Gewinn: Die Haushaltskasse der Stadt wird geschont, das Klima weniger durch Emissionen belastet und die Schülerinnen und Schüler können das Gelernte auch zu Hause anwenden, mit der entsprechenden Breitenwirkung.
Die Stadt Oranienburg hat im April 2024 erstmals Klimaaktionstage durchgeführt. Eine Energiemesse auf dem Schlossplatz, Filmvorführungen, Vorträge und Entdeckertouren waren nur einige der Programmpunkte. Ein Highlight war die Abschlussveranstaltung der aktiven Klimaschulen am 25. April 2024 in der Orangerie des Schlossparks Oranienburg. Die teilnehmenden Schulen wurden durch Bürgermeister Alexander Laesicke in einem feierlichen Rahmen geehrt.
„Kinder sollen eigentlich viel von Erwachsenen lernen. Dabei gilt das gleiche auch umgekehrt: Ihr seid in vielen Dingen viel näher am Zahn der Zeit und dürft den Erwachsenen auch gerne sagen, wenn ihr wisst, wie etwas bessergeht. Gerade wenn es um so etwas Wichtiges wie den Klimaschutz geht“, ermunterte Bürgermeister Alexander Laesicke die Schülerinnen und Schüler, ihr erworbenes Klima-Wissen weiter zu streuen.


Im Jahr 2022 hat die Stadt Oranienburg ein Klimaschutz- und Energiesparprojekt für ihre städtischen Schulen gestartet. Es wird vom Unabhängigen Institut für Umweltfragen – UfU e.V. und dem Klimaschutzmanagement der Stadt Oranienburg durchgeführt. Im April 2024 konnten bereits zum zweiten Mal die aktiven Klima-Schulen der Stadt ausgezeichnet werden. Daniel Buchholz leitet das Kompetenzzentrum Klimaneutrale Schulen im UfU und ist begeistert: „Eigene Ideen entwickeln und diese gemeinsam in der Schule umsetzen: Das macht Kids richtig Spaß. Sie starten vor Ort ganz unterschiedliche Aktionen für mehr Klimaschutz. Fast nebenbei senken sie dabei die Energiekosten der Stadt und machen uns alle unabhängiger von teuren Energieimporten. Besser geht es kaum.“
Die Energiesparprojekte sind eine bewährte Kombination aus praktischen Experimenten und Projekten sowie Unterrichtseinheiten. Die Schülerinnen und Schüler bilden Energieteams, besichtigen mit Hausmeistern die Heizungsanlage und führen zahlreiche Messungen in der eigenen Schule durch. Im laufenden Schuljahr wurden vermehrt Langzeitmessungen mit sog. Datenloggern durchgeführt und ausgewertet. Außerdem war diesmal das richtige Lüftungsverhalten ein Hauptthema. Dabei kommt eine Nebelmaschine zum Einsatz, die gesundheitlich unbedenklichen Diskonebel im Klassenraum verteilt, bis der Raum komplett eingenebelt ist. Anschließend können verschiedene Lüftungsmethoden ausprobiert werden, und anhand des Nebels kann schnell gesehen werden, welche Lüftungsmethode die effektivste ist: Querlüftung
Im Unterricht und in AGs beschäftigten sich die Schülerinnen und Schüler intensiv mit Fragen des Klimaschutzes und erarbeiteten eigene Ideen und Lösungen, mit denen an der Schule nachhaltig Energie gespart werden kann. So erfahren sie Selbstwirksamkeit und werden aktiv in die Prozesse der Schule eingebunden. Zum ersten Mal fand in diesem Schuljahr eine Fortbildung speziell für Hausmeister statt. Die Teilnehmenden von 16 Schulen und weiteren öffentlichen Gebäuden informierten sich über Energiekennwerte, Heizkurven, Absenktemperaturen und die wichtige Frage, wer in welcher Organisationseinheit die richtige Ansprechperson für gewünschte Änderungen ist.
„Das Schulprojekt ist ein wichtiger Beitrag für die angestrebte Klimaneutralität von Oranienburg“, erklärt Johanna Hornig, Klimaschutzmanagerin der Stadt. „Mit dem vielfältigen Programm der Klimaaktionstage zeigt Oranienburg, dass es die Themen Nachhaltigkeit und Ressourcenschutz auch darüber hinaus ernst nimmt und umfassend voranbringen möchte.“
Das gemeinnützige Umweltforschungsinstitut UfU unterstützt das Klimaschutzmanagement der Stadt Oranienburg bei der Durchführung der Projekte in den Schulen. Projektleiter Oliver Ritter vom UfU sieht die Erfolge: „Es wurde schon viel erreicht und wir freuen uns, dass die Stadt Oranienburg das Sparpotenzial auch in den kommenden Jahren gemeinsam mit uns heben will. In dieser Runde haben mehr als 200 Schülerinnen und Schüler direkt teilgenommen, die mit den Aktionen an ihren Schulen insgesamt 2.300 Schülerinnen und Schüler erreicht haben.“
Bei der feierlichen Veranstaltung am 25. April 2024 in der Orangerie im Schlosspark Oranienburg haben mehrere Schulen ihre Projekte und Aktionen vorgestellt. Entsprechend vielfältig waren die Darbietungen der Schulklassen, die nacheinander mit ihren Lehrkräften auf die Bühne kamen. Sie stellten selbstgedrehte Videos, Klima-Gedichte, einen selbstgebauten Solar-Roboter und ein eigens komponiertes Lied vor. Rund 100 Kinder und Lehrkräfte waren bei der feierlichen Veranstaltung in der Orangerie dabei, die mit einem turbulenten Klima-Quiz für alle begann. Als teilnehmende städtische Schulen wurden in diesem Schuljahr ausgezeichnet: Comenius Grundschule, Grundschule Germendorf, Havelschule (Grundschule), Jean-Clermont-Oberschule, Neddermeyer Grundschule Schmachtenhagen und die Waldschule (Grundschule).
Das Klimaschutz- und Energiesparprojekt der Stadt Oranienburg hat damit auch im zweiten Jahr seine Wirksamkeit unter Beweis gestellt und ist ein Erfolg. Das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz geförderte und vom UfU betreute Projekt wird im kommenden Schuljahr fortgesetzt. Bis 2025 soll der Energieverbrauch der Schulen weiter kontinuierlich gesenkt und Nachhaltigkeitsthemen an Oranienburgs Schulen verankert werden. Das Projekt geht auf einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung aus dem Jahr 2021 zurück, der darauf abzielt, die Themen Klimaschutz und Energie stärker in die schulinternen Abläufe und Lehrpläne zu integrieren und weiter in die Bevölkerung zu tragen.
Auch die Stadt Oranienburg berichtet über die diesjährige Auszeichnungs-Veranstaltung für Schulen auf ihrer Webseite: https://oranienburg.de/index.php?object=tx,2967.5&ModID=7&FID=2967.4481.1


Digitale Beteiligung souverän gestalten – Praxisleitfaden nun online!
Zugänglichere und ansprechendere Beteiligung durch Digitalisierung
Wie können die etablierten Beteiligungsformate in den digitalen Raum übertragen werden? Was muss bei der Umsetzung von digitalen Formaten beachtet werden? Und wie lassen sich die neuen Möglichkeiten nutzen, ohne dass die Qualität der Beteiligung darunter leidet?
In dem Projekt E-Partizipation Umwelt, gefördert durch das UBA und BMUV, wurde ein Praxisleitfaden entworfen, der Behörden Orientierung wie auch konkrete Hilfestellungen bei der Organisation digitaler Beteiligungsformate liefert. Durch die Realisierung des Leitfadens als Webseite „Digitale Beteiligung souverän gestalten“ konnte ein interaktives Format geschaffen werden, welches u.a. Auskunft über juristische Hintergrundinformationen sowie praktische Hinweise zur Planung und Durchführung digitaler Erörterungstermine als Videokonferenzen gibt. Der Praxisleitfaden ist seit Neuestem online zugänglich!
Bereits die gut besuchte Abschlussveranstaltung des Projekts am 22. Februar 2024 machte deutlich, dass das Thema digitale Beteiligung auf reges Interesse stößt, insbesondere auch bei der Zielgruppe der Verwaltung. Wie eine Abfrage zu Beginn der Online-Veranstaltung zeigte, verfügt der Großteil der Teilnehmenden bislang noch über keine Erfahrungen mit digitalen Erörterungsterminen, woraus sich ein direkter Bedarf nach Wissenstransfer sowie Erfahrungsaustausch ableiten lässt. Der erarbeitete Praxisleitfaden setzt an dieser Stelle an, und liefert eine Grundlage, auf der in Zukunft gezielt aufgebaut werden kann.
Die Entwicklung der Digitalisierung von Beteiligung
Die Digitalisierung der Beteiligung entwickelt sich seit Jahren stetig weiter und nimmt dabei verschiedenste Formen an: Von der Online-Einsicht in Antragsunterlagen bis hin zur Einreichung von Ideen über Beteiligungsplattformen. In Reaktion auf die COVID-19-Pandemie und die damit einhergehenden Kontaktbeschränkungen verzeichnete die Öffentlichkeitsbeteiligung, wie viele andere Bereiche auch, einen starken Digitalisierungsimpuls. Vor allem durch das Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG) aus dem Jahr 2020 wurde die Durchführung digitaler Beteiligungsformate in Planungs- und Genehmigungsverfahren in Deutschland vorangetrieben und gesetzlich verankert. So konnten Erörterungstermine fortan durch sogenannte Online-Konsultationen, d.h. digitale schriftliche Verfahren, oder Video- und Telefonkonferenzen ersetzt werden. Diese Regelungen wurden nun Großteils verstetigt und gesetzlich weiter verankert. Digitalen Erörterungsterminen in Form von Videokonferenzen wird von vielen Beteiligten, im Vergleich zu einem schriftlichen digitalen Verfahren, ein größerer Mehrwert zugeschrieben. Aufgrund des dialogischen Formates von Videokonferenzen kann ein direkterer Austausch erfolgen, offene Fragen schnell geklärt und Missverständnisse ausgeräumt werden.
Worin liegt der Mehrwert digitaler Beteiligungsformate?
Digitale Beteiligungsformate bieten die Möglichkeit Beteiligungshürden abzubauen und Teilen der Bevölkerung, insbesondere auch weniger beteiligungs-affinen Menschen, die Teilnahme zu erleichtern. Durch die Ortsunabhängigkeit der Veranstaltung und des damit verbundenen Wegfalls der Anfahrtszeiten können Menschen derartige Beteiligungsveranstaltungen leichter in ihren Alltag integrieren. Das kommt insbesondere Personen zugute, deren Zeitkapazitäten stark begrenzt sind, wie jene mit einer hohen Arbeits- bzw. Sorgearbeitsbelastung. Zudem können digitale Formate vor allem für jüngere Generationen attraktiver und leichter zugänglich erscheinen. Auch bei Personen, die über wenig Beteiligungserfahrung verfügen, kann die digitale Teilnahme eine geringere Hürde darstellen als Präsenzveranstaltungen, die i.d.R. in einem formelleren Rahmen stattfinden. Auch können digitale Formate Personen die Teilnahme erleichtern, deren Mobilität eingeschränkt ist.
Dabei ist nicht zu vergessen, dass die Verlagerung von Beteiligungsformaten in den digitalen Raum auch neue Hürden, vor allem für wenig digital-affine Personengruppen, aufbaut. Unsicherheiten mit der Technik, fehlende Ausstattung oder unzureichende Internetverbindung sind Aspekte, die die Teilnahme stark erschweren kann. Lösungen, die in der Praxis bereits Anwendung finden, sind u.a. leicht verständliche und bebilderte Anleitungen der nötigen Software, eine telefonisch erreichbare Ansprechperson bei Fragen und technischen Problemen oder auch die Zurverfügungstellung von Internetfähigen Endgeräten durch die Organisator*innen. Generell sollte stets ein besonderes Augenmerk auf die potenziellen Barrieren der digitalen Öffentlichkeitsbeteiligung gelegt werden und wie diesen entgegen zu wirken ist.
Neben den Fragen der Zugänglichkeit von digitalen Formaten, wirkt sich die Digitalisierung auch auf die Organisation von Beteiligung aus. Bei der digitalen Öffentlichkeitsbeteiligung entfallen einige organisatorische Aufgaben und Kosten. Dazu gehört etwa die Raumsuche und -miete für analoge Veranstaltungen sowie Anfahrtszeiten. Hierin steckt Potenzial für effizientere Abläufe. Der anfängliche Mehraufwand, d.h. der Zeit- und Organisationsaufwand, der mit neuen Abläufen, Aufgaben und Verantwortlichkeiten einhergeht, kann über die Zeit gesenkt werden. Selbiges trifft auch auf Anschaffungskosten zu, bspw. technischer Ausstattung, die sich über die Zeit amortisieren. Was digitale Beteiligung wohl nicht leisten wird, ist zu einer umfangreichen Beschleunigung von Verfahren beizutragen. Die Stellschrauben dazu liegen an anderen Stellen.
Letztendlich birgt die Digitalisierung der Öffentlichkeitsbeteiligung viel Potenzial. Inwiefern das Versprechen der Digitalisierung von effizienten, niedrigschwelligen und schnellen Prozessen wirklich erfüllt werden kann, sollte bei der Planung und Durchführung von digitalen Formaten jeweils fallspezifisch bewertet werden. Digitale Beteiligungsformate führen nicht automatisch zu besseren Verfahren. Der Einsatz und die Etablierung dieser sollte gezielt erfolgen, um die Vorteile für die Beteiligten zu nutzen und den Prozess gleichzeitig anschlussfähig zu gestalten.
UfU führt erstmals Energiesparprojekte in Marzahn-Hellersdorf durch!
25. März 2024
UfU führt erstmals Energiesparprojekte in Marzahn-Hellersdorf durch!
Marzahn-Hellersdorf wird erster Berliner Bezirk mit Energiemonitoring im Projekt
Zu Beginn des zweiten Schulhalbjahres führt das UfU ein neues Energiesparprojekte an Schulen in Marzahn Hellersdorf durch. Die Energiesparprojekte haben eine lange Tradition im UfU. In den letzten 25 Jahren hat das UfU mehr als 1000 Schulen im Bereich Energiesparen betreut und gemeinsam mit Lehrpersonal und Schüler*innen den Ressourcenverbrauch an Schulen gesenkt. Dass es jetzt auch zwei Projekte in Marzahn-Hellersdorf gibt freut uns besonders, denn in diesem Bezirk führen wir zum ersten Mal Energiesparprojekte durch.
Energiemonitoring – Zum ersten Mal Teil eines Energiesparprojektes
Die Energiesparprojekte an Schulen sollen Schüler*innen für Fragen des Energiesparens und des Ressourcenschutzes sensibilisieren und gleichzeitig durch das Ergreifen von Energiesparmaßnahmen Selbstwirksamkeitserfahrung vermitteln. Über einen Zeitraum von zwei Jahren führen wir an dem Melanchthon-Gymnasium und dem Siemens-Gymnasium vertiefte pädagogische Beratung durch und arbeiten gemeinsam mit den Schüler*innen an der Reduktion des Ressourcenverbrauchs der Schulen.
Neben der intensiven energietechnischen Untersuchung der Schule und der Etablierung eines Energieteams wird auch zum ersten Mal ein Energiemonitoring in ein Berliner Energiesparprojekt integriert. Im Gegensatz zu den bisherigen Projekten in Berlin bedeutet dies, dass der Energieverbrauch an den Schulen transparent, sowie Mehrverbräuche und Einsparerfolge schnell sichtbar gemacht werden. Dadurch wird die Motivation gestärkt und die Hausmeister*innen bekommen eine Qualitätskontrolle, um konkrete Maßnahmen zum Energiesparen validieren zu können. Das UfU stellt die hierfür die nötigen technischen Ressourcen zur Verfügung, unterstützt die Hausmeister*innen bei der Eingabe der Daten, führt Plausibilitätsprüfungen durch und wertet die Daten unter Anwendung einer Benchmarkanalyse aus.
Projektdetails:
In dem Projekt sollen nichtinvestive bis geringinvestive Maßnahmen identifiziert werden, um Energie einzusparen. Zu den nicht-investiven Maßnahmen gehören organisatorische Maßnahmen wie die Etablierung von Energieteams, die Optimierung der Anlagensteuerung der Heizung und die Implementierung oder Erweiterung eines Energiemanagements durch kontinuierliche Erfassung und Steuerung des Strom-, Wärme- und Wasserverbrauchs in Kooperation und engen Austausch mit dem bezirklichen Energiemanagement. Außerdem wird erörtert, wie eine kontinuierliche Sensibilisierung bei den Schüler*innen und Lehrer*innen für klimaschonendes Verhalten sichergestellt werden kann.
Zu den geringinvestiven Maßnahmen gehören z.B. Austausch von Thermostatventilköpfen, Austausch der Leuchtmittel und Installation von Präsenzschaltern, Austausch von Kaltwasserarmaturen oder der Einsatz von Wasserspareinsätzen.
Warum gibt es die Energiesparprojekte?
Die Energiekosten von öffentlichen Gebäuden in Deutschland belaufen sich jährlich auf ca. 6 Milliarden Euro! Dabei gehören Schulen allein aufgrund ihrer großen Anzahl, 32.206 Schulen in Deutschland, neben Krankenhäusern zu den größten Energieverbrauchern der öffentlichen Hand und tragen somit auch zu einem hohen CO2-Fußabdruck bei. Mittelgroße Schulen haben ungefähre Energiekosten von 150.000 Euro im Jahr, Tendenz steigend. Nicht nur für klamme Kommunen und Schulträger ist deshalb die Reduktion der Verbräuche aus ökonomischer Sicht sinnvoll. Schulen sind vielmehr auch Orte des Lernens und dienen als wichtige Multiplikatoren. Lernen Kinder hier früh, dass ihr eigenes Verhalten und ihr Umgang mit Ressourcen einen Unterschied machen kann, tragen sie dieses Wissen in ihrem Umfeld weiter und erleben gleichzeitig Selbstwirksamkeit in einer Zeit, in der globale Krisen wie der Klimawandel unveränderbar erscheinen. Mit unseren Energiesparprojekten lassen sich die Ressourcenverbräuche an Schulen im Schnitt um 10% senken.
UfU Studie: Stand der digitalen Öffentlichkeitsbeteiligung in Umweltfragen in fünf EU-Mitgliedstaaten
Gemeinsam mit Partner*innen aus Estland, Ungarn, Slowenien und Spanien haben wir den Stand der digitalen Öffentlichkeitsbeteiligung in Umweltfragen in fünf EU-Mitgliedstaaten und die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie untersucht.
Die digitale Öffentlichkeitsbeteiligung in Umweltfragen ist ein wesentliches Element moderner Demokratie, da eine effektive Einbeziehung der Öffentlichkeit zu informierteren Entscheidungen führt, die den Umweltschutz stärken. Gegenwärtig werden die Möglichkeiten der digitalen Beteiligung jedoch nur rudimentär und bruchstückhaft genutzt. Eine Stärkung der digitalen Beteiligungsverfahren durch die Behörden in den EU-Mitgliedstaaten kann daher zu einer solideren und umfassenderen Öffentlichkeitsbeteiligung im Allgemeinen führen. Ziel dieser Studie ist es, den aktuellen Stand der digitalen Öffentlichkeitsbeteiligung in fünf EU-Mitgliedstaaten zu bewerten, um eine erste Wissensgrundlage zu schaffen. In Zukunft können die gewonnenen Informationen genutzt werden, um die digitalen Fähigkeiten und Kapazitäten innerhalb von Genehmigungsbehörden zu verbessern.
Die Studie untersucht den unterschiedlichen Einsatz digitaler Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung in der EU in Bezug auf die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP). Es wird deutlich, dass es kein gemeinsames Verständnis darüber gibt, wie digitale Instrumente zur Förderung und Erleichterung der Öffentlichkeitsbeteiligung zu regeln und einzusetzen sind. Dieser vergleichende Ansatz kann die Behörden der Mitgliedstaaten jedoch dazu anregen, bewährte Verfahren aus den vorgestellten Ländern zu übernehmen und aus bestehenden Mängeln zu lernen.
Verbesserungsvorschläge
Nach der Bewertung der Situation in den fünf untersuchten Ländern ergeben sich die folgenden Verbesserungsvorschläge für eine effektive digitale Öffentlichkeitsbeteiligung.
UVP-Portale
- Einrichtung eines einheitlichen nationalen UVP-Portals.
- Alle Projekte und ihre relevanten Unterlagen werden auf dem UVP-Portal veröffentlicht.
- Nicht-technische Zusammenfassung des Projekts und der Umweltverträglichkeitsstudie sind verfügbar.
- Die Dokumente sind in einem benutzerfreundlichen Format herunterladbar.
- Die Dokumente sind vollständig und in einem vordefinierten Ablagesystem mit leicht identifizierbaren Dateinamen organisiert.
- Suchfunktion zum Auffinden von Fällen, Dokumenten und Text innerhalb von Dokumenten.
- Durchsuchbare Archivfunktion zum Auffinden von Informationen über abgeschlossene Projekte.
- Automatische Benachrichtigungen über Projekte in einem bestimmten Bereich oder Interessengebiet (z. B. per E-Mail oder App).
- Das UVP-Portal ermöglicht direkte Kommentare zu Projekten ohne langwieriges Registrierungsverfahren.
- Die Antworten auf die Kommentare der Teilnehmenden sind öffentlich und leicht online zugänglich.
Öffentliche Anhörungen
- Online und offline zugänglich (Hybrid).
- Einrichtung von Online-Anhörungen ohne vorherige Zustimmung aller Teilnehmenden.
- Die betroffene Öffentlichkeit kann jederzeit an der Anhörung teilnehmen.
Allgemein
- Spezifische separate Gesetzgebung zur elektronischen Öffentlichkeitsbeteiligung.
- Die Standards für die elektronische Öffentlichkeitsbeteiligung müssen genauso hoch sein wie die für die persönliche Beteiligung.
- Finanzierung von Pilotprojekten.
- Verbreitung von Informationen über soziale Medien.