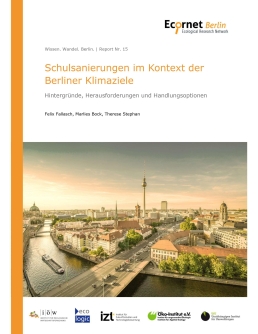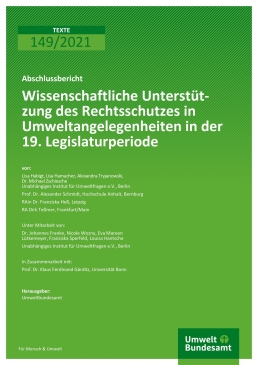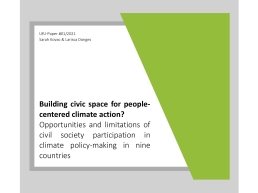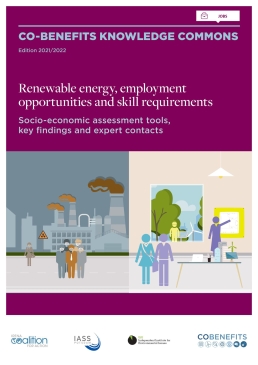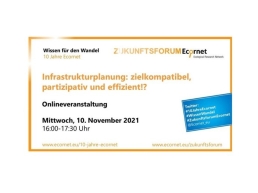UfU in der TAZ! Unsere Studie zur Verbandsklage findet Beachtung!
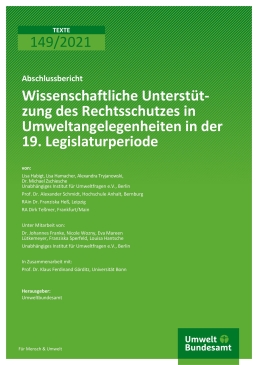
21. Dezember 2021
Die Taz berichtet über das UfU !
In einem knapp dreijährigen Forschungsprojekt hat das Unabhängige Institut für Umweltfragen zusammen mit der Hochschule Anhalt im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) und des Umweltbundesamts (UBA) das Klagegeschehen anerkannter Umweltverbände in der Bundesrepublik Deutschland seit der Novelle des Umweltrechtsbehelfsgesetzes im Jahr 2017 umfassend begleitet und anhand empirischer Daten untersucht und bewertet.
Über die Ergebnisse dieser Studie berichtet die TAZ am 21. Dezember 2021 in ihrem Artikel: „Die Natur kann sich nicht wehren“, von Christian Rath!
Schulsanierungen im Kontext der Berliner Klimaziele
20. Dezember 2021
Der Fachbereich Energieeffizienz und Energiewende veröffentlicht im 15. Ecornet Berlin Report von Wissen. Wandel. Berlin seine Arbeit zu Schulsanierungen. In der Veröffentlichung mit dem Titel Schulsanierungen im Kontext der Berliner Klimaziele wird über das Forschungsvorhaben „Wärmewende in öffentlichen Nichtwohngebäuden“ berichtet. Der Report gibt einen Überblick über den Zusammenhang zwischen Schulsanierungen und den Klimaschutzzielen für öffentliche Gebäude in Berlin. Ein Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Berliner Schulbauoffensive (BSO), in deren Rahmen die Planung und Umsetzung der Schulsanierungen koordiniert werden. Der Report zeigt auf, inwieweit sich Möglichkeiten und Bedarfe für eine stärkere Verschränkung der beiden Themen Schulsanierungen und Klimaschutz ergeben.
UfU Verbändeworkshop zur Verbandsklage
01. Dezember 2021
Verbände-Workshop
Verbandsklagen im Umwelt- und Klimaschutz
aktuelle Entwicklungen zu Klagen und neueste Ergebnisse aus Studien
Datum: 10. Dezember 2021
Uhrzeit: 10:00 Uhr – 13:45 Uhr
Ort: Digital
Ansprechpartnerin: Louisa Hantsche
In einem knapp dreijährigen Forschungsprojekt hat das Unabhängige Institut für Umweltfragen zusammen mit der Hochschule Anhalt im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) und des Umweltbundesamts (UBA) das Klagegeschehen anerkannter Umweltverbände in der Bundesrepublik Deutschland seit der Novelle des Umweltrechtsbehelfsgesetzes im Jahr 2017 umfassend begleitet und anhand empirischer Daten untersucht und bewertet. In diesem Rahmen fanden bereits mehrere Fachveranstaltungen statt.
Die Veranstaltung bietet einen umfassenden Überblick über die Ergebnisse der Studie sowie zu aktuellen Entwicklungen und Problemen im Umweltrechtsbereich, speziell zur Umweltverbandsklage. In den Diskussionsrunden haben Sie die Möglichkeit, sich über die Themen, Thesen und Impulsvorträge auszutauschen und Ihre persönlichen Erfahrungen zu teilen.
Das Programm richtet sich dabei ausschließlich und exklusiv an Vertreterinnen und Vertreter anerkannter Umwelt- und Naturschutzverbände.
UfU-Vortrag an der Bucerius Law School zum Thema Recht und Biodiversität

24. November 2021
UfU-Vortrag bei Ringvorlesung der Bucerius Law School zum Thema Recht und Biodiversität
Der Klimawandel betrifft uns alle und für einen effektiven Klimaschutz bedarf es eines umfassenden und interdisziplinären Austauschs. Letztlich spiegelt sich die politische Realität immer in Gesetzen wider und umso wichtiger ist es, den juristischen Blick für andere Fachbereiche offen zu halten und vice versa.
In der öffentlichen Ringvorlesung „Zukunft Klimawandel: Herausforderungen einer vorhersehbaren Krise“ des Studium generale der renommierten Bucerius Law School – Hochschule für Rechtswissenschaft in Hamburg wurden deshalb umweltpolitische, ökonomische und gesellschaftliche Aspekte beleuchtet und durch juristische Fachbeiträge ergänzt.
Neben Dr. Florian Dirk Schneider vom Institut für sozial-ökologische Forschung referierte UfU-Umweltjuristin Louisa Hantsche in diesem Rahmen am 23. November 2021 zum Thema Biodiversität und den damit zusammenhängenden juristischen Herausforderungen.
Insbesondere zwischen Artenschutz und Klimaschutz sehen Umweltakteur*innen ein großes Spannungsverhältnis, welches es politisch und letztlich auch juristisch zu beseitigen gilt.
UfU widmet sich in zahlreichen Projekten diesem und weiteren umweltrechtlichen Themen und verfolgt dabei stets einen interdisziplinären und zugleich bürgernahen Ansatz. Siehe dazu unsere Projekte in den Bereichen Umweltrecht und Biodiversität.
Moderiert wurde die Veranstaltung von Prof. Dr. Michael Fehling LL.M. Berkeley, Lehrstuhlinhaber Öffentliches Recht III – Öffentliches Recht mit Rechtsvergleichung der Bucerius Law School.
KlimaGesichter: Interkulturelle Umweltbildung – EinProjekt geht zu Ende

18. November 2021
Bremerhaven, 11. November 2021 – Abschlusskonferenz des KlimaGesichter-Projektes:
Um die Gesellschaft für die Folgen des Klimawandels, die Thematik der Klimagerechtigkeit sowie der klimabedingten Migration zu sensibilisieren, hat das UfU gemeinsam mit der Deutschen Klimastiftung und der Jugendwerkstatt Felsberg im Projekt KlimaGesichter Menschen mit Flucht- und Migrationserfahrung sowie interessierte Klimaschützer*innen zu Klimabotschafter*innen ausgebildet. Ziel dabei war es, dass die Klimabotschafter*innen eigene Klima-Workshops durchführen und ihr gewonnenes Wissen in Kombination mit ihrer persönlichen Geschichte erzählen, um dem Klimawandel sprichwörtlich ein Gesicht geben.
Zum Abschluss des KlimaGesichter-Projektes fand am 11. November 2021 im Klimahaus Bremerhaven 8° Ost zum Thema klimabedingter Migration- und Flucht das SymposiumWarum Menschen vor dem Klima fliehen?! statt.
Es war eine Veranstaltung der Begegnungen und des Austauschs, der Ideenfindung und der Vernetzung. Eingeleitet wurde die Konferenz am Vorabend mit einem Tiefsee-Dinner, eindrücklich emotional begleitet durch den musikalischen, interkulturellen Verein Trimum e.V., der die gesamte Veranstaltung umrahmte und mitgestaltete.
Das Symposium selbst wurde am 11.11.2021 durch eine starke und beeindruckende Keynote von Peter Emorinken Donatus eröffnet, der uns wachrüttelte, aus unserer Wohlfühlblase rausholte und unsere eigene Verantwortung aufzeigte. Des Weiteren gab es musikalische Einlagen von Trimum e.V., unter anderem in Zusammenarbeit mit den KlimaGesichtern, die in einer musikalischen Version ihre eigenen Geschichten und Perspektiven mit den Teilnehmenden teilten.
Da zeitgleich die UN-Klimakonferenz in Glasgow stattfand, wurde Sven Harmeling von CARE von der COP26 zugeschaltet, um einen ersten Einblick in die Gespräche vor Ort zu bekommen und gemeinsam Fragen der Klimagerechtigkeit zu diskutieren.
Der Nachmittag bestand aus einer Workshopphase im Talanoa-Format, aufgeteilt in drei Workshops: Wo stehen wir, wo wollen wir hin und wie kommen wir dahin? Dazu bot Mechthild Becker vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) einen Workshop zum Thema: Was sind „Klimaflüchtlinge“? an. Merlin Pratsch von der Environmental Justice Foundation beschäftigte sich in seinem Workshop mit dem politischen und rechtlichen Rahmen zur Klimaflucht. Im dritten Workshop widmeten sich Volker von Witzleben von Ben&Jerry´s und das KlimaGesicht Dr. Tsiry Rakotoarisoa gemeinsam möglichen Visionen einer klimagerechten Welt. Die verschiedenen Ergebnisse, Ansätze und Perspektiven wurden im Anschluss zusammengetragen, diskutiert und Handlungsempfehlungen daraus abgeleitet.
Zum Abschluss gab Dr. Dino Laufer, einer der Entwickler des Projektes, eine eindrückliche Zusammenfassung der letzten drei Jahre und bekräftigte die momentane und fortlaufende Relevanz und Aktualität des Themas Klimawandel und Klimaflucht. Gemeinsam mit den 70 Teilnehmende wurde bei der Veranstaltung viel gelernt, reflektiert und diskutiert. Es war ein Tag des Austauschs, der Emotionen und des gemeinsamen Aufbruchs.
Aus diesem Tag und dem gesamten Projekt nehmen wir die Erkenntnis mit, dass wir erst am Anfang stehen und noch viel passieren muss, damit Menschen nicht mehr aufgrund des Klimawandels fliehen müssen, dass wir in Deutschland eine Verantwortung gegenüber unseren Mitmenschen auf der Welt haben und dass die Politik bzw. unsere Regierung die Fluchtursache Klimawandel bekämpfen muss, anstatt die Flucht selber.
Auch weiterhin möchten die 45 KlimaGesichter und das UfU weiter für das Themenfeld Klimawandel sensibilisieren und sich für die Schicksale der Menschen einsetzen, die schon heute von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind.

UfU Paper 01/2021 zu klimapolitischen Beteiligungsprozessen
12.11.2021
UfU Paper 01/2021 zu klimapolitischen Beteiligungsprozessen
UfU Paper zeigt Stärken und Schwächen von Prozessen für zivilgesellschaftliche Beteiligung in der Klimapolitik in neun Ländern auf
Im Rahmen des Projektes ZIVIKLI hat das UfU die Studie Civic space for participation in climate policies in Colombia, Georgia and Ukraine veröffentlicht. Diese Studie umfasste auch ein Kapitel zu „Good Practice“-Beispielen für klimapolitische Beteiligungsprozesse auf nationaler Ebene.
Nach der Veröffentlichung der Studie wurde in Diskussionsrunden und Veranstaltungen mit Repräsentant*innen der klimabewegten Zivilgesellschaft oftmals die Frage nach Schwächen der untersuchten Beteiligungsprozesse und Möglichkeiten für deren Verbesserung aufgeworfen. Diese Ergebnisse wurden aufgrund der Fokussierung des oben genannten Kapitels auf Good Practice-Aspekte bisher nicht veröffentlicht.
Mit dem UfU Paper 1/2021 Building civic space for people-centered climate action? Opportunities and limitations of civil society participation in climate policy-making in nine countries möchten die Autorinnen die Analyse erweitern und die Ergebnisse ihrer umfassenden Recherchen darstellen. So zeigt das UfU Paper 1/2021 sowohl Stärken als auch Schwächen jedes untersuchten Beteiligungsprozesses auf, und gibt erste Vorschläge für die Verbesserung der untersuchten Prozesse.
Erneuerbare können Arbeitsmärkte stärken
09. November 2021
Erneuerbare können Arbeitsmärkte stärken
Der ambitionierte Ausbau von erneuerbaren Energien birgt ein großes Potenzial zur Schaffung neuer Jobs, zeigt Teil 1 der Co-benefits Knowledge Commons Factsheets Series 2021/2022
Teil 1 der Edition 2021/2022 der Co-benefits Knowledge Commons gibt einen Einblick in den aktuellsten Stand der Forschung zu erneuerbaren Energien und damit verbundenen Entwicklungen von Arbeitsmärkten. Die Veröffentlichung zeigt: Erneuerbare können in vielen Ländern nachhaltige Job schaffen und das Geschlechterverhältnis bei Arbeitsplätzen im Energiesektor verbessern.
Um diese Entwicklungschancen voll ausschöpfen zu können, ist ein ambitionierter Ausbau von erneuerbaren Energien unerlässlich. Regierungen sollten diesen jedoch mit unterstützenden Politiken in Sektoren wie Forschung und Entwicklung sowie Bildung begleiten, um so den für die Energiewende notwendigen Pool an Fachkräften, Wissen und Know-how aufzubauen.
Die Co-benefits Knowledge Commons Factsheet Edition Employment opportunities and skill requirements möchte politische Entscheidungsträger*innen mit Fachorganisationen und Kontaktpersonen vernetzen, um weiterhin Beschäftigungspotenziale zu quantifizieren und politische Handlungsoptionen zu beurteilen. So können Co-benefits für Menschen und Gemeinschaften zugänglich gemacht werden. Die Factsheets bauen zudem eine Brücke zwischen Wissenschaftler*innen und Entscheidungsträger*innen, indem sie letzteren verlässliche Daten zur Kopplung von klimafreundlicher Energieplanung mit der nachhaltigen Schaffung von Arbeitsplätzen an die Hand geben.
Die Factsheet Serie wird vom Projekt COBENEFITS, in Zusammenarbeit mit der Sustainable Energy Jobs Working Group unter der Coalition for Action der IRENA veröffentlicht. UfU hat gemeinsam mit dem IASS die Knowledge Commons Factsheet Series kuratiert. Die Veröffentlichung kann auch auf der COBENEFITS Projektseite aufgerufen werden.
Siebte Vertragsstaatenkonferenz der Aarhus-Vertragsparteien (MoP 7)
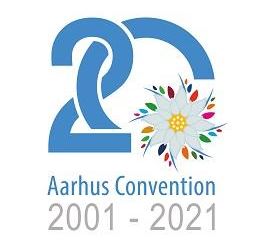
03. November 2021
UN-Verhandlungen zur Förderung der Umweltdemokratie
Am 30. Oktober 2021 wird die Aarhus-Konvention – die Konvention über den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten – zwanzig Jahre alt. Wenige Tage zuvor kamen die Vertragsparteien, Unterzeichnerstaaten, internationalen Organisationen, die Zivilgesellschaft und andere Interessengruppen in Genf zusammen, um die Errungenschaften und aktuellen Herausforderungen bei der Förderung von Umweltdemokratie, digitaler Transformation und nachhaltiger Entwicklung zu diskutieren. Die Diskussionen zur Aarhus-Konvention und ihr PRTR-Protokoll – das Kiew-Protokoll über Schadstofffreisetzungs- und –verbringungsregister – konzentrierten sich darauf, wie nachhaltige Infrastrukturen und Raumplanung gefördert werden.
Das Ziel der Aarhus-Konvention und seines Protokolls ist der Schutz des Rechts jeder Person gegenwärtiger und künftiger Generationen auf ein Leben in einer seiner Gesundheit und seinem Wohlbefinden zuträglichen Umwelt zu leben. Dieses Ziel erweist sich heute angesichts der zahlreichen ökologischen Krisen als noch wichtiger denn je. Trotz beachtlicher Erfolge stehen viele Länder noch vor großen Herausforderungen im Umwelt- und Menschenrechtsschutz. Zahlreiche Regierungen ergriffen angesichts der Coronavirus-Pandemie (COVID-19) Maßnahmen, die die bürgerlichen Freiheiten im Umweltbereich einschränken. Viele Regierungen riefen nationale Notstände aus und verabschiedeten zahlreiche Maßnahmen, die zwar vordergründig die Ausbreitung des Virus einschränken sollten. Häufig gingen damit jedoch auch erhebliche Einschränkungen der Versammlungs- und Bewegungsfreiheit einher. Die COVID-Maßnahmen beschnitten oder haben das Potential, auch das Recht der Öffentlichkeit auf Zugang zu Informationen, auf Beteiligung an Entscheidungsverfahren und auf Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten zu beschneiden. Gleichzeitig leistete die Pandemie der Digitalisierung der Umweltverwaltung und der digitalen Beteiligung der Öffentlichkeit enormen Vorschub.
Vom 18. bis 22. Oktober 2021 fanden im Nationalpalast im Schweizer Genf Verhandlungen zwischen Vertragsparteien der Aarhus-Konvention und des PRTR-Protokoll statt, um die aktuellen Entwicklungen zu beraten:
| Dates | Meetings |
| 18. bis 20. Oktober 2021 | Siebte Vertragsstaatenkonferenz der Aarhus-Vertragsparteien (MoP 7)
Seventh session of the Meeting of the Parties to the Aarhus Convention |
| 21. Oktober 2021 | Gemeinsames hochrangiges Segment der Aarhus- und PRTR-Parteien |
| 22. Oktober 2021 | Vierte Vertragsstaatenkonferenz der PRTR-Vertragsparteien (MoPP 4)
Fourth session of the Meeting of the Parties to the Protocol on PRTRs |
Die Beschlüsse des Aarhus-Konvention Compliance-Ausschusses
Im Rahmen des MoP 7 bestätigten die Aarhus-Vertragsparteien insgesamt 20 Feststellungen und Empfehlungen des Aarhus-Konvention Compliance-Ausschusses (Aarhus-Ausschuss). Auf drei Beschlüsse, die sich auf die Nichteinhaltung der Aarhus-Konvention durch Deutschland (1.) und die Europäische Union (2.) beziehen, sind hervorzuheben. Auch auf einen Beschluss zu Weißrussland (3.) ist einzugehen.
1. Zugang zu Gericht für Umweltverbände in Deutschland
Die Vertragsparteien nahmen die Feststellungen und Empfehlungen des Aarhus-Ausschusses gegen Deutschland an (ACCC/C/2016/137). Das Komitee stellte fest, dass Deutschland gegen das internationale Aarhus-Recht verstößt. Das Anerkennungskriterium der basisdemokratischen Verfasstheit für Umweltvereinigungen ist zu streng. Das Kriterium verwehrt in unzulässiger Weise, dass Umweltverbände Umweltentscheidungen vor deutschen Gerichten prüfen lassen können.
Aus diesem Grund verpflichten die Aarhus-Parteien Deutschland nun, deutsches Recht zu ändern. Ganz konkret ist § 3 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes zu streichen. Durch die Gesetzesänderung werden zukünftig Umweltstiftungen wie WWF Deutschland oder Vereine wie Greenpeace Deutschland klagen können.
UfU wird diesen Anpassungsprozess mit seiner Expertise in den kommenden Monaten begleiten.
2. Zugang zu Gericht in der Europäischen Union
Die Europäische Union ist selbstständige Vertragspartei der Aarhus-Konvention. Auch sie muss Aarhus-Recht einhalten. In gleich zwei öffentlichen Rügeverfahren stellte der Aarhus-Ausschuss fest, dass der europäischen Öffentlichkeit und Umwelt-NGOs kein ausreichender Zugang zu europäischen Gerichten gewährleistet wird.
Die Aarhus-Vertragsparteien nahmen die Feststellungen und Empfehlungen des Aarhus-Ausschusses zum Fall ACCC/C/2008/32 an, nachdem die Europäische Union diese Annahme (engl. „endorsement“) bei der letzten Vertragsstaatenkonferenz in Budva (Montenegro) auf dem MoP 6 im Jahr 2017 blockierte. Die NGOs hofften, dass mit dieser Annahme auch gleichzeitig die Feststellungen und Empfehlungen zum Fall (ACCC/C/2015/128) angenommen werden. Aufgrund der erneuten Blockadehaltung durch die Europäische Union, wurden die Feststellungen und Empfehlungen des Aarhus-Ausschusses diesbezüglich nicht verabschiedet. Die Bestätigung der Feststellungen und Empfehlungen des Aarhus-Komitees wurde erneut auf die nächste Vertragsstaatenkonferenz in rund vier Jahren verschoben. Die NGO-Delegation konnte zumindest darauf hinwirken, dass die Vertragsparteien festhalten, dass diese erneute Sonderbehandlung bzw. Ausnahmeentscheidung für die Europäische Union in keiner Weise eine Praxis im Rahmen des Aarhus-Übereinkommens begründet.
Das UfU wird auch in den kommenden Jahren dafür kämpfen, dass Bürger*innen und Umwelt-NGOs Umweltentscheidungen, wie zum Beispiel europäische Beihilfeentscheidungen, auf EU-Ebene überprüfen lassen können. Eine erneute Änderung der gerade erst novellierten Aarhus-Verordnung ist dafür unumgänglich.
Mehr Informationen zur Aarhus-Konvention und ihrer Umsetzung in der Europäischen Union und Deutschland siehe: http://www.aarhus-konvention.de/
3. Schutz von Umweltschützer*innen und NGOs in Weißrussland
Die Verhandlungen wurden von den akuten Menschenrechtsverletzungen in Weißrussland überschattet, die gegenüber Umweltschützer*innen verübt wurden. Zum ersten Mal in der zwanzigjährigen Vertragsgeschichte wurde eine beschwerdeführende NGO, die belarussische NGO „Ecohome“, während eines laufenden öffentlichen Beschwerdeverfahrens aufgelöst. Die Staatengemeinschaft reagierte auf die Verletzungen fundamentaler Rechte von Umweltschützer*innen damit, dass Weißrussland ab dem 1. Februar 2022 seine besonderen Rechte und Privilegien unter der Konvention entzogen werden, sollte Weißrussland „Ecohome“ nicht wieder als öffentlichen Verein anerkennen.
Das UfU verurteilt die Bestrafung, Verfolgung oder Belästigung von Umweltschützer*innen auf das Schärfste! Das UfU unterstützt alle weißrussischen Umwelt-NGOs und Umweltschützer*innen im Rahmen seiner Möglichkeiten.
Weitere Ergebnisse:
UN-Sonderberichterstatter*in für Umweltschützer*innen
Aufgrund der sich verschlechternden Menschenrechtslage in Weißrussland und anderen Vertragsstaaten, wo Umweltschützer*innen zunehmend bestraft, verfolgt oder belästigt werden, installierten die Aarhus-Parteien einen sog. English „Rapid Response Mechanism“. Im Zuge dessen wird im Jahr 2022 ein*e UN-Sonderberichterstatter*in für Umweltschützer*innen berufen, um international Menschenrechtsverletzungen sichtbar zu machen.
Zwei neue Mitglieder im Aarhus-Ausschuss
Die Aarhus-Parteien folgten nicht nur zahlreichen Feststellungen und Empfehlungen des Aarhus-Ausschusses, sondern sie wählten ebenfalls zwei neue Mitglieder in das quasi-gerichtliche UN-Gremium. Die ehemalige Richterin des Europäischen Gerichtshofs Eleanor Sharpsten und unser langjährige und geschätzte UfU-Kollegen Thomas Schomerus. Mehr Informationen rund um seine NGO-Nominierung sind hier zu finden: https://www.ufu.de/en/nomination-of-prof-dr-thomas-schomerus-to-serve-the-aarhus-committee-of-the-united-nations-by-a-strong-alliance-of-european-environmental-ngos/
Guinea-Bissau erster afrikanischer Vertragsstaat der Aarhus-Konvention
Ein historisch bedeutsames Ereignis auf dem MoP 7 war der Beitritt des westafrikanischen Landes Guinea-Bissau zur Aarhus-Konvention. Damit hat die Vertragsstaatenkonferenz den ersten Staat außerhalb der UNECE-Region in den Kreis der Aarhus-Staaten aufgenommen. Die gemeinsame Hoffnung ist, dass dieser vorbildhafte Schritt weitere Staaten Asiens oder Afrikas animiert, wie beispielsweise die Mongolei oder Usbekistan, der Konvention zur Umweltdemokratie beizutreten.
GVO-Novelle fehlt nur noch ein Vertragsstaat zum Inkrafttreten
Albanien hat als 32. Staat die GVO-Novelle ratifiziert. Diese sieht die öffentliche Beteiligung an geplanten Freisetzungen gentechnisch veränderter Organismen (GVOs) vor. Damit fehlt nur noch die Ratifizierung der GVO-Novelle von einer der folgenden Staaten, damit die Vertragsänderung der Aarhus-Konvention völkerrechtlich in Kraft tritt: Armenien, Aserbaidschan, Weißrussland, Kasachstan, Kirgisistan, Nordmazedonien, Tadschikistan, Turkmenistan und Ukraine.
Goodbye Jeremy Wates als Aarhus-NGO-Beobachter!
Den intergouvernementalen Verhandlungen, die erstmals im hybriden Format stattfanden, wohnten zahlreiche nichtstaatliche Beobachterorganisationen aus dem NGO-Sektor und der Wissenschaft bei. Zukünftig wird unsere Kollegin Summer Kern vom österreichischen Ökobüro eine besondere Rolle im zwischenstaatlichen Prozess einnehmen. Sie löst Jeremy Wates, Generalsekretär des European Environmental Bureau (EEB), als offizielle NGO-Beobachterin ab. Wir sagen Danke Jeremy für deinen langjährigen bedeutenden Beitrag zur Förderung der Umweltdemokratie!
Wo und wann genau die nächste Aarhus- und PRTR-Vertragsstaatenkonferenz (MoP 8 und MoPP 5) in rund vier Jahren stattfinden wird, ist noch unklar. Klar ist aber, dass das UfU auch dort wieder als unabhängiger NGO-Beobachter dabei sein wird!
Mehr Informationen rund um den MoP 7 und MoPP 4 sind hier zu finden: https://unece.org/climate-change/press/governments-and-stakeholders-strengthen-commitment-environmental-democracy
Weitere Fragen rund um die Vertragsstaatenkonferenzen beantwortet: Larissa Donges
Pressekontakt: Jonas Rüffer
Lokale Klimakleinprojekte in Mittelvietnam gehen in die dritte Runde

01. November 2021
Wie in den Vorgängerprojekten in 2019 und 2020 unterstützt das UfU auch in diesem Jahr wieder lokale Kleinprojekte in Mittelvietnam für die Sensibilisierung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen für lokale Fragen des Klimawandels und für klimafreundlichere Handlungsoptionen sowie für den Kapazitätsaufbau der Jugend für mehr Klimaschutzmaßnahmen. Mit Mitteln des Klimafonds des Auswärtigen Amtes und in Zusammenarbeit mit dem Mientrung Institute for Scientific Research (MISR) ermöglicht das UfU talentierten und jungen Vietnames*innen ihre eigenen Projektideen zu entwickeln und vor Ort umzusetzen.
Anfang des Jahres konnten sich junge Menschen aus Mittelvietnam mit ihren eigenen Projektideen beim Ideenwettbewerb des UfU und MISR bewerben. Von allen Bewerbungen wurden die vier besten Projektideen für eine Förderung und anschließende Umsetzung ausgewählt.
In diesem Jahr wurden die folgenden Kleinprojekte ausgewählt:
- Sensibilisierung für den Klimawandel durch einen Schulgarten. Ein Demonstrationsprojekt an der Hoa Phuoc Grundschule, Hoa Vang Bezirk, Da Nang Stadt. Projektentwicklung und –umsetzung durch die Studierenden Kieu Thi Phuong, Phan Minh Luu An, Van Thi Thao Vy, Bui Van Quoc Trung und Tran Quang Huy.
- Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Kohlenstoffspeicherkapazität von Seegraswiesen zur Eindämmung des Klimawandels und zur Minimierung von Aktivitäten, die zu einer Verschlechterung des Seegrasökosystems in der Lagune von Lang Co in der Provinz Thua Thien Hue führen. Projektentwicklung und –umsetzung durch die Studierenden Nguyen Huu Chi Tu und Nguyen Tu Uyen.
- Gründung eines Clubs zur Prävention und Anpassung an den Klimawandel im Bezirk An Dong in der Stadt Hue. Projektentwicklung und –umsetzung durch die jungen Lehrenden Le Thi Thanh Nhan und Tran Thi Ngoc Cam des Hue Medical College.
- Erhöhung des Bestands an einheimischen Baumarten und eines Produktionswaldes im Dorf Cam Nghia, Bezirk Cam Lo, Provinz Quang Tri. Projektentwicklung und –umsetzung durch Nguyen Van Ky Truong, Nguyen Xuan Tam und To Minh Hanh.
Das Gesamtprojekt und der Start der vier Kleinprojekte wurden mit einem Kick-Off-Workshop am 26. September offiziell eingeläutet. Unter den 25 Teilnehmenden befanden sich neben den Projektteams die Mentor*innen einiger Teams, einige Projektgewinner*innen aus den letzten Jahren sowie weitere interessierte junge Menschen. In einer freundlichen und produktiven Atmosphäre wurde seitens des UfU eine Einführung in Projektmanagement gegeben, während im Anschluss die Herausforderungen und Vorhaben aller Projekte diskutiert und Lösungs- und Verbesserungsvorschläge gemeinsam erörtert wurden. Bis Ende Februar 2022 werden die Kleinprojekte nun unter der Unterstützung von UfU und MISR implementiert und begleitet.
Infrastrukturplanung: zielkompatibel, partizipativ und effizient!?
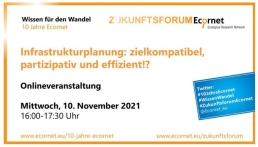
29. Oktober 2021
Infrastrukturplanung – Aber richtig!
Der Infrastrukturausbau in Deutschland muss sich mehr und mehr an gesteigerten Klimazielen und den Dekarbonisierungsnotwendigkeiten orientieren. Gleichzeitig braucht es weiterhin die Beteiligung der Öffentlichkeit, um die Bevölkerung bei den anstehenden Veränderungsprozessen einzubeziehen sowie die demokratischen Errungenschaften zu gewährleisten. Das Heben von Effizienzpotentialen in Planungsprozessen gilt daher als Schlüssel, um zielgerichteter in den kommenden Jahren den Infrastrukturausbau zu bewältigen.
Die Ecornet-Institute forschen seit langem in diesem Bereich. Neben Evaluationsprojekten kümmern sie sich auch um neuartige Planungskonzepte. In der Veranstaltung sollen daher Möglichkeiten und Grenzen der Planungsbeschleunigung thematisiert und sinnvolle Ansätze zusammen mit Experten*innen diskutiert werden.
| Veranstalter: | Ecological Research Network (Ecornet) |
| Datum: | Mittwoch, 10. November 2021
16:00-17:30 Uhr |
| DURCHFÜHRUNG: | Online als digitale Veranstaltung
Die Zugangsdaten erhalten die Teilnehmenden im Vorfeld der Veranstaltung per Mail. |
| HINTERGRUND: | Deutschland muss umgebaut werden: Die ambitionierten Klimaziele erfordern neue Infrastrukturen. Rad- und Fußwege, Wärmenetze, der Ausbau von Speichern, Strom- und Schienennetzen, eine Wasserstoffinfrastruktur für die Industrie, einen völlig veränderten Kraftwerkspark und anderes mehr. Gleichzeitig ist die Beteiligung der Öffentlichkeit entscheidend, um die Bevölkerung bei den anstehenden Veränderungsprozessen einzubeziehen sowie die demokratischen Errungenschaften zu gewährleisten. Planung muss aber auch effizienter werden, damit wir rechtzeitig die erforderliche gesellschaftliche Transformation bewältigen. Denn Klimaschutz ist auch eine Zeitfrage.
Die Ecornet-Institute forschen seit langem in diesem Bereich. Sie evaluieren bestehende und entwickeln neue Planungskonzepte, welche die drei Ziele „zielkompatibel, partizipativ und effizient“ verbinden. In der Veranstaltung sollen daher Möglichkeiten und Grenzen der Planungsbeschleunigung thematisiert und sinnvolle Ansätze mit Experten*innen diskutiert werden. |
| EXPERT*innen: | Dr. Martin Pehnt
Wissenschaftlicher Geschäftsführer des ifeu – Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg Dr. Michael Zschiesche Geschäftsführer und Leiter des Fachgebiets „Umweltrecht & Partizipation“ des Unabhängigen Instituts für Umweltfragen (UfU) Prof. Dr. Kai Niebert Präsident des Deutschen Naturschutzrings (DNR) Eva Maria Niemeyer Hauptreferentin im Dezernat „Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen und Verkehr“ des Deutschen Städtetags Franziska Flachsbarth Senior Researcher am Institutsbereich „Energie & Klimaschutz“ des Öko-Instituts Silvia Schütte Senior Researcher am Institutsbereich „Umweltrecht & Governance“ des Öko-Instituts Moderation: Larissa Donges Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachgebiet „Umweltrecht & Partizipation“ des Unabhängigen Instituts für Umweltfragen (UfU) |
| Kontakt: | Ecological Research Network (Ecornet)
Roy Schwichtenberg Tel.: +49 30 8845 9424 (aufgrund der Corona-Pandemie ist das Büro derzeit unregelmäßig besetzt) |