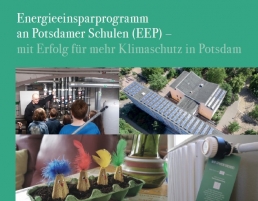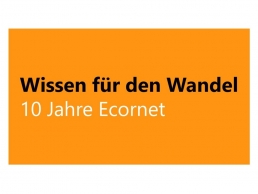Bürgerrat „Deutschlands Rolle in der Welt“ – Für mehr Klimaschutz!

21. Oktober 2021
Bürgerrat „Deutschlands Rolle in der Welt“ – Wir müssen für Klimaschutz Verantwortung übernehmen!
Der Bürgerrat – ein durch Los und nach bestimmten Kriterien zusammengestelltes Gremium, welches den Querschnitt der Bevölkerung abbilden und zukunftsrelevante Themen besprechen soll, so die Idee. Für den zweiten bundesweiten Bürgerrat in Deutschland wurden 169 Teilnehmende aus verschiedenen Bundesländern nach den Kriterien Wohnort, Wohnortgröße, Alter, Geschlecht, Bildungsgrad und Migrationshintergrund per Los ausgewählt um über Corona, Welthandel, Friedenssicherung, Entwicklungshilfe, Migration oder Umweltschutz zu diskutieren.
Organisiert wird der Bürgerrat vom Verein Mehr Demokratie e.V. und LOS. Bei einem Bürgerrat kommen immer Politik, Zivilgesellschaft und Wissenschaft zusammen. Wissenschaftliche Institute und weitere Einrichtungen versorgen die Teilnehmenden dabei mit wichtigen Informationen zu den Themenfeldern und stehen repräsentativ für die Meinung der Wissenschaft. Die Teilnehmenden können diese Informationen in die Diskussion mit einfließen lassen und sind so befähigt, über die Themen fundiert zu debattieren. Das UfU war für diesen Bürgerrat als Experte geladen und hat die Umwelt- und Klimathemen zusammengefasst.
Ziel des Bürgerrates
Der Bürgerrat ist ein relativ neues Instrument in Deutschland. Es soll, wenn tauglich als weiteres Partizipationsformat in Deutschland dienen und dem Parlament wichtige Impulse für die Ausrichtung von Zukünften geben. Gerade bei zukunftsweisenden Themen wie Klimaschutz oder Welthandel kann der Bürgerrat eine Einschätzung darüber geben, wie sich die deutsche Bevölkerung zu diesen Themen verhält und der Politik wichtige Richtungen aufzeigen.
Thema Klimaschutz
Das UfU hat in diesem Bürgerrat die Umwelt- und Klimathemen zusammengefasst, ein wichtiges Teilthema von „Deutschlands Rolle in der Welt“. Dabei konnte festgestellt werden, dass das Thema Klimaschutz bei dem Großteil der Teilnehmer*innen eine wichtige Rolle spielt und die Bewältigung der mit dem Klimaschutz einhergehenden Aufgaben als zukunftsrelevant angesehen werden. Die Teilnehmenden haben Empfehlungen zum Wasserschutz, Erhaltung der Biodiversität und nachhaltigem Wirtschaften formuliert. Es wurde deutlich, dass sich auch in Deutschland Wirtschaft und Konsum an dem Prinzip der Nachhaltigkeit messen lassen soll. Schutz der biologischen Vielfalt und eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft wird vom Rat empfohlen. Die genauen Ergebnisse hat das UfU zusammengefasst: Umweltpolitische Empfehlungen des Bürgerrats „Deutschlands Rolle in der Welt“ (PDF)
Verantwortung Deutschlands
Die Teilnehmenden des Bürgerrates machen unmissverständlich klar, dass sie Deutschland eine Vorbildfunktion in Fragen des Klimaschutzes zuschreiben. Die Politik müsse sich ihrer Verantwortung gewahr werden und alles dafür tun, das Deutschland als Beispiel für guten Klimaschutz gelten kann. Vor allem auch in Bezug auf Länder des Globalen Südens und anderen „benachteiligten“ Staaten sei Deutschland verpflichtet, Kooperationen einzugehen und nachhaltige Entwicklungen zu fördern.
Relevanz der Ergebnisse
Die Ergebnisse, die der Bürgerrat auf dem Themenfeld Umwelt- und Klimaschutz erarbeitet hat, sind dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zugespielt worden. Die partizipative Rolle der Bürgerräte ist jedoch noch begrenzt. Die Ergebnisse werden zwar dem Bundestag und den entsprechenden Ministerien übermittelt, haben jedoch für diese keine Verbindlichkeit. Laut UfU sollte sich dies in Zukunft ändern, um aus dem Bürgerrat kein Alibiinstrument werden zu lassen. Wie genau die Bürgerräte in den Prozess mit eingebunden werden und wie weit die Ergebnisse rechtliche Relevanz haben können, darüber lässt sich diskutieren. Aber echte Partizipation ist nur möglich, wenn die Ergebnisse dieser Partizipation auch in irgendeiner Weise die politisch Verantwortlichen binden.
Das UfU wird sich in Zukunft für mehr Bürgerräte in Deutschland einsetzen.
Umweltpolitische Empfehlungen des Bürgerrats „Deutschlands Rolle in der Welt“ (PDF)
Energieeinsparprogramm (EEP) - Klimaschutz an Potsdamer Schulen
18. Oktober, 2021
Energieeinsparprogramm an Potsdamer Schulen (EEP) – mit Erfolg für mehr Klimaschutz in Potsdam – neue Broschüre erschienen!
Die Stadt Potsdam hat schon früh erkannt, dass es gerade an Schulen enorme Einsparpotentiale gibt. Seit 1998 gibt es deshalb das Energieeinsparprogramm an Potsdamer Schulen (EEP). Das Programm stellt jedes Jahr 60.000 EUR an Prämien für Energiesparmaßnahmen an Schulen bereit. Schulen können sich für die Teilnahme an diesem Programm bewerben und erhalten dadurch neben der monetären Unterstützung für konkrete Energiesparprojekte auch pädagogische Begleitmaterialien.
Wie funktioniert das Ganze?
Schulen, die aktiv teilnehmen, profitieren von den vielzähligen Angeboten des Projekts: Workshops, Rundgänge und das jeweilige, begleitete EEP-Jahresprojekt mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten vermitteln Kompetenzen und regen zu Energieeinsparung und Klimaschutz an. Über die ausgeführten Maßnahmen sammeln die Schulen Punkte in einem Prämiensystem.
Seit 2017 setze das UfU die Maßnahmen zusammen mit der Berliner Energieagentur (BEA) um, welches durch den Kommunalen Immobilien Service (KIS) im Auftrag des Fachbereiches Bildung, Jugend und Sport der Landeshauptstadt Potsdam realisiert wird. Durch das Projekt EEP soll das bisher erreichte Energieverbrauchslevel an den Potsdamer Schulen gehalten und künftig unterschritten werden.
In den vergangenen Jahren beteiligten sich jeweils 38 Potsdamer Schulen aktiv daran. So erarbeiteten Schüler*innen Konzepte dafür, wie an der eigenen Schule das Abfallaufkommen reduziert werden kann oder es etablierten sich bereits seit langem verantwortlichen Dienste von Schüler*innen für Heizkörper, Fenster/Türen, Licht oder Abfalleimer, welche tatkräftig zu Energieeinsparungen beitragen.
Klimaschutz gelingt dann am besten, wenn aus tollen Ideen und erfolgreichen Aktionen dauerhafte Routinen entstehen. Die Potsdamer EEP-Schulen zeigen mit vielen guten Beispielen, wie das geht.
Mehr zum Programm und den Erfolgen können Sie nun auch in der offiziellen Broschüre zum Projekt nachlesen sowie auf der eigens für das EEP eingerichteten Website: www.energieeinsparprojekt-potsdam.de
Die vollständige Broschüre zum Programm finden Sie hier: EEP-Potsdam_Programmbroschüre (PDF)
10 Jahre Ecornet! Ein Netzwerk das Wissen und Wandel schafft!

14. Oktober, 2021
10 Jahre Ecornet
Das Netzwerk der unabhängigen Institute der Umwelt- und Nachhaltigkeitsforschung wird zehn Jahre alt.
2011 haben sich acht gemeinnützige Wissenschaftseinrichtungen – darunter das Unabhängige Institut für Umweltfragen – zum Ecological Research Network (Ecornet) zusammengeschlossen, um, die wissenschaftliche Arbeit rund um Nachhaltigkeit, Umwelt-, Klima- und Ressourcenschutz noch stärker in den öffentlichen und politischen Fokus zu rücken. Ihr gemeinsames Ziel: wissenschaftlichen Background für die Gestaltung einer nachhaltigen Welt liefern, Lösungen für die dafür notwendigen Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft entwickeln und Handlungsoptionen mit den vielfältigen Akteuren zu diskutieren.
Die Institute arbeiten in unterschiedlichen Konstellationen regelmäßig an verschiedenen Projekten zusammen. Gleichzeitig findet regelmäßig die Veranstaltungsreihe Zukunftsforum Ecornet statt, bei welchem die Institute wichtige Themen der Zukunft diskutieren. Im Rahmen des Jubiläums finden mehrere Zukunftsforen statt.
Die Jubiläumspressemitteilung können Sie hier lesen: Pressemitteilung_10-Jahre-Ecornet (PDF)
Mitglieder des Ecornet sind:
- Ecologic Institut
- ifeu – Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg
- Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW)
- ISOE – Institut für sozial-ökologische Forschung
- IZT – Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung
- Öko-Institut
- Unabhängiges Institut für Umweltfragen (UfU)
- Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie
KlimaVisionen - Teilnahme ab sofort möglich!

12. Oktober, 2021
KlimaVisionen – Teilnahme ab sofort möglich!
Interessierte Schulen können sich ab jetzt für das UfU-Projekt KlimaVisionen anmelden.
Das UfU-Projekt KlimaVisionen erstellt in gemeinsamer Zusammenarbeit zwischen Schulen, Schüler*innen und dem UfU individuelle Roadmaps für den Weg hin zur klimaneutralen Schule. Ziel ist, durch thematische Inputs und Workshops, einen KlimaCheck sowie eine Beratung konkret umsetzbare Projekte zu finden und so den Weg für eine klimaneutrale Schule der Zukunft zu ermöglichen.
Das Projekt besteht aus mehreren zentralen Punkten:
- Klimacheck: Im KlimaCheck wird herausgefunden, wo in der Schule der größte Handlungsbedarf besteht.
- Themen-Workshops: In den Themen-Workshops wird mit den Schüler*innen und Lehrenden das Thema Klimaneutralität erarbeitet. Dabei werden neben der Wissensvermittlung auch die Gestaltungs- und Handlungskompetenzen gefördert.
- Sprechstunde: In der Sprechstunde erhalten die Schulen Unterstützung und es wird der Erfahrungsaustausch mit anderen am Projekt teilnehmenden Schulen ermöglicht.
Folgende Workshops werden unter anderem angeboten:
Zur genauen Projektbeschreibung geht’s hier: https://www.ufu.de/projekt/klimavisionen/
Zur Projektanmeldung geht’s hier: https://www.ufu.de/klimavisionen-anmeldung/
Three4Climate inspiriert zur emissionsfreien Reise durch Europa

2. Oktober 2021
Ein Lehrerteam aus Bielefeld (Deutschland) nimmt die Challenge an und reist emissionsfrei nach Loulé (Portugal) um an einem Lehrkräfteaustausch des EU-Klimaprojekts „Three4Climate“ an der Algarve teilzunehmen.
Wie kann man eine Strecke von fast 3.000 Kilometern ohne lokale Emissionen zurücklegen? Tobias Dewald und Jens Ohlemeyer, die beteiligten Lehrer vom Friedrich-von-Bodelschwingh-Gymnasium in Bielefeld/Bethel, ahnten zu Beginn schon, welche Herausforderung die Antwort auf diese Frage mit sich bringen würde. Das Ziel des Three4Climate-Projekts der drei aufeinanderfolgenden EU-Ratspräsidentschaften von Deutschland, Portugal und Slowenien, bis 2050 die Klimaneutralität zu erreichen, nahmen die beiden Lehrer aus Bielefeld sehr ernst. Die Bielefelder waren überzeugt, dass es für diese Reise einen ganzheitlichen und innovativen Ansatz braucht. So entwickelten sie den anspruchsvollen Plan die Fernreise mit drei verschiedenen Arten von lokal emissionsfreien Verkehrsmitteln zu unternehmen: Elektroauto, Zug und Elektrofahrräder. Die ersten 2.300 Kilometer von Bielefeld/Deutschland zur Projektpartnerschule in Braga/Portugal sollten mit einem Elektroauto (Mercedes-Benz EQV) zurückgelegt werden, das genug Platz für die zwei Lehrer und ihre Schul-E-Bikes bietet. Weiter sollte es von Braga über Lissabon nach Beja (weitere 500 Kilometer) mit dem Zug gehen. Von Beja nach Loulé sollten zwei der Elektrofahrräder des Friedrich-von-Bodelschwingh-Gymnasiums als Transportmittel für die letzten 150 Kilometer dienen.
Am Freitag, den 1. Oktober um 4.00 Uhr morgens, starteten Tobias Dewald und Jens Ohlemeyer den elektrische Roadtrip in Bielefeld. Sie mussten sich an einen sehr strikten Plan halten, um die verfügbaren HPCs (Hyper-Ladestationen) auf dem Weg zu erreichen, um am Sonntag rechtzeitig in Braga zu sein. Glücklicherweise waren alle HPCs in Deutschland, Belgien und Frankreich einwandfrei und die Batterie konnten in 45 bis 60 Minuten von 10 % auf 100 % aufgeladen werden. In Brüssel trafen sich Tobias Dewald und Jens Ohlemeyer mit Katerina Fortun von der Europäischen Kommission um die dringenden Forderungen der Three4Climate-Schüler*innen nach mehr Klimaschutz Maßnahmen in der Europäischen Union zu übergeben.
Am Sonntagmorgen, 3. Oktober, wurden die beiden Lehrer von der Partnerschule in Braga empfangen und fuhren mit ihren E-Bikes und dem Zug nach Porto und Lissabon. Im komfortablen Zug konnten sie auch ihre persönlichen Batterien nach zwei Tagen Reise ohne viel Schlaf wieder aufladen.
Am letzten Tag der Reise, Montag, den 4. Oktober, fuhr das Lehrerteam mit dem Zug von Lissabon nach Beja und radelte 50 Kilometer nach Aljustrel/Messejana. Dort besuchten Sie ein großes 13,9 MWp-Solarkraftwerk (Strom für etwa 8.000 Haushalte), um zu zeigen und zu vermitteln, woher die Energie der Reise kommen sollte und unsere Zukunft elektrisch und emissionsfrei ist. Von dort aus waren es weitere 100 Kilometer mit dem E-Bike nach Loulé an der Algarveküste. Aufgrund des sehr hügeligen Geländes der Algarve und des vielen Gepäcks war der letzte Teil der Reise trotz der elektrischen Unterstützung der Fahrräder sehr anstrengend. Hinzu kam, dass 23 Kilometer vor dem Ziel in Loulé der erste Akku der E-Bikes und 10 Kilometer vor Loulé dann beide Akkus leer waren.
Hungrig und erschöpft, aber fest entschlossen, ihr Ziel auf dem vorgesehenen Weg mit dem Fahrrad zu erreichen, schoben die beiden Lehrer ihre Räder mit schwerem Gepäck die letzten 10 Kilometer die hügelige Algarve hinauf und kamen gegen 23 Uhr, kurz vor Mitternacht, in Loulé an.
Überglücklich über die gelungene emissionsfreie Fahrt wurden Tobias Dewald und Jens Ohlemeyer am Mittwoch, den 6. Oktober, von der Partnerschule in Loulé empfangen und arbeiteten gemeinsam mit den Lehrkräften aus Braga an Projekten zur Erreichung der Klimaneutralität in der EU bis 2050. Vitor Aleixo, der Bürgermeister von Loulé/Salir, lud den Oberbürgermeister von Bielefeld, Pit Clausen, nach Portugal ein, um den Austausch mit jungen Menschen aus beiden Ländern und Städten fortzusetzen.
Die Projektschulen von Braga, Loulé und Bielefeld werden ihre Schulkooperationen über das Three4Climate-Projekt hinaus mit offiziellen Schulpartnerschaften für zukünftige Projekte fortführen.
Aus Sicht des EU-Klimaschutzprojekts war der Austausch ein großer Erfolg. Viele inspirierende Ideen für wirksame Klimaschutzmaßnahmen entstanden mit der Forderung nach einer verstärkten Bildung für Nachhaltige Entwicklung in den Schulen. Zusätzlich zu den Klimaschutzzielen und -maßnahmen stärkte das Three4Climate-Projekt auch die Beziehungen zwischen den drei beteiligten Ländern Portugal, Slowenien und Deutschland, da neue Freundschaften quer durch Europa entstanden sind.
Neuigkeiten aus dem Three4Climate Projekt

01. Oktober 2021
Am 1.10.2021 ist die „e-cross Germany goes Europe“ Reise von Bielefeld nach Loulé gestartet! Die beiden Three4Climate Lehrer aus Bielefeld, Jens Ohlemeyer und Tobias Dewald, sind unterwegs zum Lehrkräfte-Austausch in Portugal. Unter diesem Link könnt ihr den beiden bei den verschiedenen Etappen ihrer Reise folgen und findet Neuigkeiten von unterwegs.
https://ecross-germany.de/three4climate-e-cross-germany-goes-europe/
Der erste Zwischenstopp ist in Brüssel bei der DG Clima. Während das Auto läd, kann im Livestream verfolgt werden, wie die Forderungen der Schüler aus Portugal, Slowenien und Deutschland, die am Three4Climate-Projekt teilnehmen, werden an die Generaldirektion für Klimapolitik der Europäischen Kommission am 1. Oktober in Brüssel übergeben werden.
Wieder dürfen Hannoveraner Schulen CO2-Ampeln bauen

30. September 2021
Am 29.09.2021 fand im Energie-LAB der Leonore Goldschmidt Schule der erste von insgesamt drei CO2-Ampelbau-Workshops im Schuljahr 2021-22 in Präsenz statt. Diesmal leitet das UfU, in Person von Frau Dorina Schacknat (Ingenieurin und Schulbetreuerin des UfU) die Selbstbau-Workshops im Auftrag des Schulbiologiezentrums Hannover an. Die Schülerinnen und Schüler von drei weiterführenden und einer berufsbildenden Schule erfuhren zunächst in spannenden Experimenten von Frau Dr. Virdis (koordinierende Lehrkraft des Energie-LABs) mehr über die Eigenschaften und Wirkweise von CO2. Neben seinem Beitrag zum Klimawandel wurde der Einfluss von CO2 auf das Raumklima verdeutlicht. Energiesparendes Querlüften war anschließend ein Thema.
Im Anschluss bauten die Schülerinnen und Schüler jeweils in Zweierteams ihre Materialien zusammen und programmierten in der loT-Werkstatt mit Hilfe einer graphischen Oberfläche ihre eigene CO2-Ampel. Sie ließen das Display CO2 und Temperatur anzeigen und die LED entsprechend des CO2-Gehaltes grün (unter 1.000 ppm), gelb (1.000-1.500 ppm) und rot (über 1.500 ppm) leuchten. Die Schülerinnen und Schüler wurde dabei überaus kreativ und versuchten sich an weiteren Funktionen wie etwa einem Blinken der LED.
Zuletzt bekamen die CO2 -Ampeln ein Gehäuse und wurden mit dem jeweiligen Schullogo versehen. So sind die CO2 -Ampeln für ihren Einsatz bereit und können die Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte dabei unterstützen durchs Lüften ein gutes und möglichst infektionsarmes Raumklima zu schaffen.
Aus diesmal entstanden tolle Ampeln für den Einsatz in Coronazeiten.
Gefördert werden die drei Workshops durch die Projekteförderung des Bundeslandes Niedersachsen anlässlich seines 75. Jahrestages, die Schulen mit spannenden außerschulischen Partner*innen zusammenbringt.
Der erste vom UfU angeleitete CO2-Ampel-Workshop fand bereits im Juni 2021 statt (damals noch digital):
„Kann man noch Energie sparen, wenn alle lüften, was das Zeug hält?“
Fünfter Aarhus-Workshop zu Klimaschutzgesetzen in der EU

27. September 2021
Fünfter Aarhus-Workshop zu Menschenrechten und Klimaschutzgesetzen in der EU
Am 7. September 2021 organisierte das UfU zusammen mit slowenischen NGOs den fünften Aarhus-Workshop zum Thema: Zusammenhang von Menschenrechten, Klimaschutzgesetzen und der Aarhus-Konvention in der Europäischen Union (EU). Im Mittelpunkt stand die Frage, wie Bürger*innen und zivilgesellschaftliche Organisationen in umwelt- und klimapolitische Prozesse auf EU-Ebene und in den Mitgliedstaaten eingebunden werden.
Die 1998 von der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten verabschiedete Aarhus-Konvention legt den Grundstein für das Recht auf Information und auf Beteiligung, um eigene Vorstellungen von einem klimaneutralen Europa wirksam einbringen zu können und für Klagerechte in Umweltangelegenheiten. Aufgrund der Konvention haben die Zivilgesellschaft und Nichtregierungsorganisationen formal das Recht, vor Gericht zu gehen und EU-Entscheidungen anzufechten, wenn Umwelt- und Klimaschutzgesetze mutmaßlich verletzt werden. Beispiele für solche Verwaltungsentscheidungen sind die Genehmigung neuer Projekte für fossile Brennstoffe, Fischereiquoten, die Genehmigung staatlicher Beihilfen für Kernkraftwerke und viele mehr. Da die Europäische Union dafür kritisiert wird, dass sie Bürger*innen und Nichtregierungsorganisationen aber in der Praxis keine Möglichkeit gibt, ihre Entscheidungen zu überprüfen, wird die Aarhus-Verordnung momentan überarbeitet.
Der Workshop fand nur wenige Wochen vor der siebten Tagung der Vertragsparteien der Aarhus-Konvention (sog. „MoP 7″; vom 18. bis 21. Oktober 2021 in Genf) und somit zu einem entscheidenden Zeitpunkt statt. Denn von der Vertragsstaatenkonferenz werden richtungsweisende Entscheidungen, auch hinsichtlich des Rechtsschutzes erwartet. Daher wurde auf dem Workshop ausgiebig erörtert, ob die zu erwartende überarbeitete Aarhus-Verordnung und andere EU-Gesetze letztendlich mit der Aarhus-Konvention in Einklang sein werden und wo weiterhin Umsetzungsdefizite bestehen. Die rund 50 Teilnehmenden aus Umweltverbänden, Stiftungen, Universitäten, Regierungsorganisationen sowie Jurist*innen – vor allem aus Slowenien, Deutschland und Brüssel diskutierten auch die Herausforderungen innerhalb einzelner Mitgliedstaaten sowie Möglichkeiten, die (rechtliche) Beteiligung von Bürger*innen und NGOs am Klima- und Umweltschutz zu verbessern.
Redner*innen:
Dr. Vasilka Sancin, Assistenzprofessorin an der Universität Ljubljana & Direktorin des Zentrums für Internationales und Wirtschaftsrecht;
Dr. Roda Verheyen, LL.M., Umweltanwältin der Rechtsanwälte Günther Partnerschaftsgesellschaft;
Mag. Senka Šifkovič Vrbica, Umweltanwältin am Institut für Raumordnungspolitik (IPoP);
Sebastian Bechtel, LL.M., Jurist für Umweltdemokratie bei ClientEarth Brüssel;
Mag. Tanja Pucelj Vidovič, Focal Point für die Aarhus-Konvention im Ministerium für Umwelt und Raumordnung;
Matthias Sauer, Referatsleiter des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit;
Alistair McGlone, Direktor bei Alistair McGlone and Associates Ltd & ehemaliges Mitglied des Aarhus Convention Compliance Committee;
Dr. Maša Kovič Dine, Assistenzprofessorin an der Universität von Ljubljana;
Dr. Maria Alexandra de Sousa Aragão, Professorin an der Universität von Coimbra;
Aljoša Petek, Umweltanwältin bei PIC – Rechtszentrum für den Schutz der Menschenrechte und der Umwelt.
In der ersten lebhaften Podiumsdiskussion über das bevorstehende Treffen der Vertragsparteien der Aarhus-Konvention (MoP-7) diskutierten die Podiumsteilnehmer*innen Mag Tanja Pucelj Vidovič; Matthias Sauer und Alistair McGlone darüber, ob die Europäische Union ihren EU-Bürger*innen und NGOs ausreichenden Zugang zu den Gerichten gewährt oder nicht. Dr. Michael Zschiesche, Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender des UfU, betonte dazu: „Die Doppelmoral der Europäischen Union muss aufhören. EU-Bürger*innen und Nichtregierungsorganisationen müssen in der Lage sein, die Europäische Union zur Rechenschaft zu ziehen, wenn ihre Entscheidungen der Umwelt und dem Klima schaden, so wie die Zivilgesellschaft die Mitgliedstaaten in Umweltfragen zur Rechenschaft ziehen kann.“ Alistair McGlone unterstrich: „Die EU sollte sich für Rechenschaftspflicht und internationale Rechtsstaatlichkeit einsetzen, um zu vermeiden, dass ihr Ruf als weltweit führendere Akteur*in in Umweltforen beschädigt wird.“
Die zweite Podiumsdiskussion befasste sich mit dem Zusammenspiel von der Beteiligung der Öffentlichkeit an umweltpolitischen Entscheidungen und sogenannten Umwelt- und Klimaklagen. Dr. Maša Kovič Dine, Dr. Maria Alexandra de Sousa Aragão und Aljoša Petek formulierten es so: „Ordnungsgemäße Planungs- und Genehmigungsverfahren mit frühzeitiger, umfassender und effektiver Öffentlichkeitsbeteiligung auf Ebene der Mitgliedstaaten und der EU können langwierige und teure Rechtsstreitigkeiten vor Gericht verhindern. Aktive Bürger*innenbeteiligung verhindert langfristige finanzielle Kosten durch Umweltzerstörung.“
Die Diskussionsteilnehmer*innen waren sich außerdem einig, dass die derzeitigen Beteiligungsformate nicht den Bedürfnissen der jungen Generation entsprechen, die sich stark für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung engagiert.
Präsentationen:
– Gesamtpräsentation mit allen Vorträgen: Menschenrechte, europäische und nationale Klimagesetze und die Bedeutung der Aarhus-Konvention;
– Die Sicht der slowenischen Umwelt-NGOs auf die slowenische EU-Ratspräsidentschaft in Umweltfragen.
Presseerklärung:
Wie die Europäische Union seit zwei Jahrzehnten gegen internationales Umweltrecht verstößt.
NGOs, die den Workshop organisiert haben:
- UfU – das Unabhängige Institut für Umweltfragen,
- PIC – das Rechtszentrum für den Schutz von Menschenrechten und Umwelt,
- IPoP – das Institut für Raumordnungspolitiken
- Umanotera – die slowenische Stiftung für nachhaltige Entwicklung
- CIEL – Zentrum für internationales Recht und Wirtschaftsrecht
Über die Workshops:
In den Jahren 2020 und 2021 wurden insgesamt fünf digitale Aarhus-Workshops durch das UfU organisiert. Am 11. Mai 2020, 30. Juni 2020, 17. November 2020, 24. März 2021 und 7. September 2021 nahmen interessierte Teilnehmer*innen aus Belgien, Deutschland, Portugal und Slowenien an den Workshops teil. Ein gemeinsames Positionspapier „Deutsch-Portugiesisch-Slowenische Erklärung der Zivilgesellschaft zum Rechtszugang für Bürger*innen und NGOs auf EU-Ebene“ wurde veröffentlicht. Das UfU dankt allen, die zu den fünf Aarhus-Workshops beigetragen und zu einem Erfolg gemacht haben.
Alle Aarhus-Workshops sind Teil des Projekts „Europäische Umsetzung der Aarhus-Konvention im digitalen Zeitalter (EU-AarKo)“ des Unabhängigen Instituts für Umweltfragen UfU e.V. Dieses Projekt wird vom Umweltbundesamt (UBA) und dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit im Rahmen der Verbändeförderung gefördert.
Bei Fragen zum Thema wenden Sie sich bitte an Larissa Donges.
Weitere Informationen zur Aarhus Konvention und ihrer Umsetzung auf europäischer Ebene finden Sie hier: www.aarhus-konvention.de
Für weitere Informationen über das EU-AarKo-Projekt und seinen Hintergrund klicken Sie bitte hier.
Ein Gesetz mit Lücken - Das Berliner Klimaschutz- und Energiewendegesetz

21. September 2021
Ein Gesetz mit Lücken
UfU nimmt zum Berliner Klimaschutz- und Energiewendegesetz Stellung
Am 19. August verabschiedete das Berliner Abgeordnetenhaus eine Novelle des Berliner Klimaschutz- und Energiewendegesetzes. Ein Gesetz, dass Berlin langfristig klimaneutral machen und die Energiewende forcieren soll.
Mit der Novelle hat das Abgeordnetenhaus das Gesetz nochmal deutlich verschärft, sodass es zu den ambitioniertesten Klimaschutzgesetzen in Deutschland zählt. In seiner Radikalität, Tiefe und Kurzfristigkeit gibt es kaum ein vergleichbares Landesgesetz. Die Klimaziele wurden drastisch erhöht, der Zeitrahmen, in dem die Ziele zu erreichen sind, teilweise um bis zu 5 Jahre verkürzt.
Das UfU hat sich intensiv mit dieser Novelle auseinandergesetzt und dazu Stellung bezogen. Grundsätzlich ist zu sagen: Wir begrüßen die ambitionierten Ziele des EWG Bln sehr. Der Dringlichkeit mit der wir uns der Energiewende in Berlin stellen müssen, wird mit diesem Gesetz Rechnung getragen. Allerdings haben wir begründete Zweifel an einer Zweckmäßigkeit der Verschärfung, wenn jetzt bereits absehbar ist, dass die Zielmarken des Gesetzes verfehlt werden. Das Gesetz droht zu einem weiteren Papier mit Zielsetzungen zu verkommen, die am Ende nicht umgesetzt werden.
Unsere Kernkritik: In dem Gesetz werden behördliche Verwaltungsprozesse und ihr Zeitaufwand konsequent vernachlässigt. Es werden beispielsweise Zielmarken mit Einsparungen von 80 Prozent im Primärenergieverbrauch bei öffentlichen Gebäuden gesetzt. Gleichzeitig wird ignoriert, dass es in sieben Berliner Bezirken bereits vollständig ausgearbeitet Sanierungsfahrpläne für diese Gebäude gibt, mit deutlich geringeren Einsparpotentialen. Es müsste also entweder doppelt saniert, die Planungen grundlegend überarbeitet werden oder die Zielsetzung des Gesetzes ist schon jetzt nicht haltbar. Schulen sollen neue Effizienzstandards bekommen, ohne zu berücksichtigen, dass durch die aktuelle Schulbauoffensive die Planungsverfahren und Genehmigungen für viele Schulen bereits abgeschlossen sind. Denn Arbeiten an öffentlichen Gebäuden wie Schulen werden teilweise Jahre im Voraus beantragt und genehmigt. Das Gesetz kann also nur durch Doppelsanierungen und erhöhten finanziellen Aufwand greifen.
Wir haben viele weitere Punkte im Gesetz gefunden, die wir mit der aktuellen personellen Besetzung auf allen Verwaltungsebenen für schlicht nicht umsetzbar halten. Der akute Fachkräftemangel, auch in den Bauämtern, verhindert schnelles und punktiertes Handeln. Dies sollten die Probleme sein, mit denen sich das Abgeordnetenhaus beschäftigt, bevor es weitere Novellen von Klimaschutzgesetzen verabschiedet, die so nicht einzuhalten sind.
Link: Hier geht’s zu unserer Stellungnahme: UfU nimmt zum EWG Bln Stellung
Endlich kann das Birkenwerder Energiesparprojekt weitergehen

09. September 2021
Nach pandemiebedingten Unterbrechungen kann das 2019 gestartete Energiesparprojekt der Gemeinde nun richtig weitergehen. In Birkenwerders Kitas und der Pestalozzi-Grundschule werden in den kommenden Monaten die Kinder im Bereich Energiesparen geschult und Technik sowie Nutzungsverhalten optimiert werden.
Bürgermeister Stephan Zimniok weiß, dass die Beschäftigten in den Kitas und der Grundschule in Birkenwerder vielfältige Aufgaben und dadurch genug zu tun haben, dennoch sehe die Gemeinde Klimaschutz als wichtiges Ziel an – schließlich habe sie den Klimanotstand ausgerufen. Aus diesem Grund hat die Gemeinde Birkenwerder das Unabhängige Institut für Umweltfragen (UfU) beauftragt, mit den Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft ein Energiesparprojekt durchzuführen.
Da die Pandemie das im November 2019 begonnene Projekt unterbrochen hat und nur Teile der geplanten Projektaktivitäten umgesetzt werden konnten, trafen sich die Leitungen der Bildungseinrichtungen, der Bürgermeister sowie der Klimaschutzmanager mit dem UfU am 9. September 2021 zu einer Schul- und Kitajahres-Auftaktveranstaltung in der Aula der Pestalozzi-Grundschule Birkenwerder.
Gewohnheiten ändern, um Ressourcen zu sparen
Es sei aus verschiedenen Gründen sinnvoll, Energie zu sparen, erklärt Hoai Tran aus dem Fachgebiet Energieeffizienz und Energiewende den Anwesenden Bürgermeister Stephan Zimniok, Klimamanager der Gemeinde Stefan Golla, Doreen Wilke (Leiterin des Fachbereiches Bildung und Soziales) und den Einrichtungsleitungen Frau Baierl (Kita Festung Krümelstein), Frau Roggan (Kita Rumpelstilzchen), Frau Will (Kita Birkenpilz und Cörnchen) und Herrn Stapel (Pestalozzi-Grundschule). – Um Kosten zu senken; da die fossilen Energiequellen bald ausgeschöpft sind; um den Klimawandel zu bremsen und um ein energie- und klimabewusstes Verhalten bei den zukünftigen Erwachsenen zu stärken. All diese Ziele verfolgt das Energiesparprojekt durch technische Optimierungen und der Optimierung des Alltagsverhalten der Gebäudenutzenden. Das UfU macht dabei Maßnahmen-Vorschläge zur Reduzierung von Energieverschwendung, die Umsetzung findet teilweise in Absprache mit den Einrichtungen zusammen statt, teilweise übernehmen die Einrichtungen diese selbst direkt.
Konkret sieht das Projekt so aus: Energierundgänge durch die Einrichtungen, Team-Workshops mit Erzieher*innen und Lehrer*innen, Fortbildungen für Hausmeister*innen und mehrere Termine mit Kita- und Schulkindern. Bei Letzterem geht es um bewusstes Alltagsverhalten, beispielsweise Licht und Heizung nur dann zu nutzen, wenn sie benötigt werden und richtiges Lüften. Die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen fungieren dann als Multiplikator*innen und sollten ihr Wissen an ihre Mitschüler*innen und Freunde und ihre Familien weitergeben.